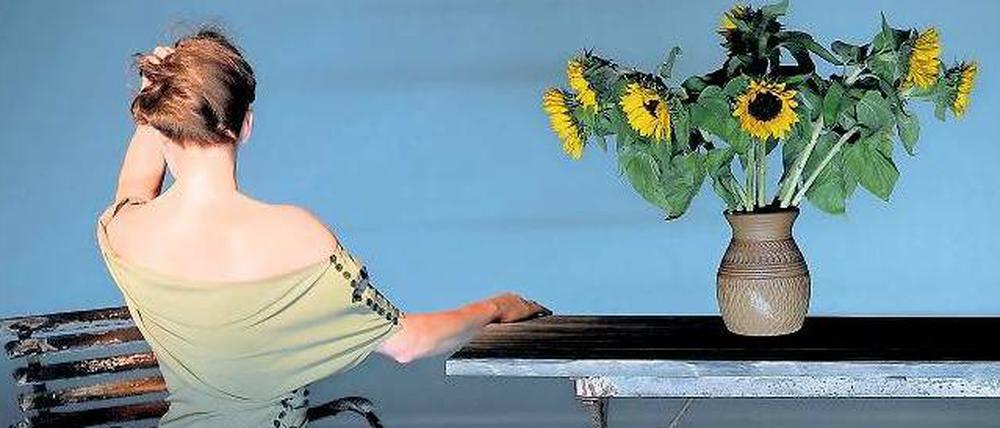
© Joachim Fieguth
Zwei Premieren am Berliner Ensemble: Das Schnattern und das Schweigen
So gegensätzlich kann Theater sein: Claus Peymann verjuxt Schillers "Kabale und Liebe" am Berliner Ensemble. Und Philip Tiedemann macht am selben Haus Eindruck mit einem Kammerspiel von Peter Handke: "Die schönen Tage von Aranjuez".
Der böse adlige Präsident von Walter (Joachim Nimtz) trägt eine orangefarbene Haartolle, geht auf Stelzen und reibt hinterhältig die Daumen gegen die Zeigefinger, während sein intrigantes Gedankengut die Augen zu Schlitzen verengt und den Mund zu einem hässlichen Viereck formt. Der gute bürgerliche Miller (Martin Seifert) ist in Weiß gekleidet, aber leider auch nicht ernst zu nehmen. Claus Peymann inszeniert am Berliner Ensemble Schillers „Kabale und Liebe“, und Achim Freyer hat dafür einen runden Kreidekreis auf die Bühne malen lassen, in den von oben hin und wieder Stühle heruntergelassen werden. Oder Geigen. Oder eine Schaukel, in der Katharina Susewind als Lady Milford im zartrosa Hochzeitskleid und mit grellpinken High Heels in den Bühnenhimmel schwingt.
Lady Milford ist in Schillers Sturm-undDrang-Drama das Bindeglied zwischen Adel (Kalkül, Machterhaltung) und Bürgertum (Rechtschaffenheit und romantische Liebe) und vielleicht die bemerkenswerteste Figur des Stücks. Eine adlige Waise aus England, die aus Not zur Mätresse des Präsidenten wird. Ihre Stellung befriedigt ihren gesellschaftlichen Ehrgeiz – andererseits knospt Sehnsucht nach echter Liebe in ihr, weshalb sie den Sohn des Präsidenten, den stürmischen Ferdinand (Sabin Tambrea), heiraten will. Als der ihr offenbart, dass er die bürgerliche Luise (Antonia Bill) liebt, setzt sie erst alles daran, die Beziehung zu beenden – doch als sie Luise selbst trifft, ist sie von deren „höherer Tugend“ so tief getroffen, dass sie ihre adlige Überheblichkeit abwirft und als Geläuterte das Land verlässt. Es zerreißt sie also; die widerstreitenden Kräfte, deren Ringen Schiller hoch dramatisch gestaltet, scheinen wie in ihrer Brust verknotet. Aber bei Claus Peymann schwingt Lady Milford bloß auf der Schaukel hin und her.
Anders gesagt: Peymann versinnbildlicht das Drama ins putzig Clowneske. In dieser märchenhaft zweigeteilten Welt der bunten Farben und Formen müssen Hofschranzen tuntenhaft stöckeln, während Sabin Tambrea als guter Ferdinand jugendwütig ausschreitet und kampfeslustig die Zähne bleckt. Norbert Stöß trägt als intriganter Haussekretär Wurm schwarze Strumpfmaske und erinnert mit seinen Rockschößen fatal an Willy aus der Biene Maja. Und die puffige Pelzstola, die Thomas Wittmanns Hofmarschall von Kalb spazieren führt, staubt bei jedem Trippelschritt so, dass die ganze Szenerie immer wieder in einer weißen Puderwolke verschwindet.
Es ist der rechte Moment, um sich aus diesem Figurenkabinett auszublenden. Denn was einen Abend später auf der Seitenbühne des Berliner Ensemble „sich ereignet“, wie Peter Handke, Autor des Abends, sagen würde, ist um einiges aufregender – eine „Geschichte, wie nur je eine“. Eine Geschichte, die von nichts weniger erzählen will als von der „Herabkunft der ergänzenden Ruhe“. Profaner ausgedrückt: Stille. Knisterndes Schweigen. Hin und wieder rauscht der Wind in den unsichtbaren Bäumen – bis es aus dem weißen Rundprospekt im Hintergrund vorzutreten scheint. Aber was?
Eine Frau und ein Mann sitzen an einem Gartentisch und reden. Mehr nicht. Peter Handkes sogenannter Sommerdialog „Die schönen Tage von Aranjuez“ behauptet nur im Titel einen Bezug zu Schillers Stück Don Karlos, das mit dem Satz „Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende“ beginnt. In Wirklichkeit geht es, wie in den letzten zwei Jahrzehnten meistens bei Handke, um den Versuch, in hunderten Anläufen das Unaussprechliche zu evozieren, das Unsagbare zwischen und mit den Wörtern aufscheinen zu lassen. Die beiden haben sich eine Art Erzählspiel ausgedacht. Es darf nicht mit Nein und Ja auf Fragen geantwortet werden, Zahlen sind auch verboten. Und zum Erzählen drängen – das geht auch nicht. Das Sujet: Die Liebe.
Rüdiger Vogler nimmt auf einem Stuhl rechts Platz, Sylvie Rohrer links. Sie ist barfuß und zieht bald einen Fuß auf die Sitzfläche, minimal aufreizend, viel mehr aber konzentriert wahrnehmend, denn mit leicht in den Nacken gelegtem Kopf scheint sie zu lauschen. Als Luc Bondy das Stück letztes Jahr in Wien uraufführte, soll er die Stille, um die es Handke geht, mit zappeligen Übersprungshandlungen überspielt haben – diesen Fehler macht Philip Tiedemann nicht. Er lässt die Stille haptisch werden, so dass man nach fünf Minuten Kaum-was-sagen und sporadischem Windrauschen tatsächlich glaubt, an einem Sommerabend auf dem Land zu sein.
„Deine erste Nacht mit einem Mann?“ fragt Vogler schließlich. Doch stattdessen erzählt die Frau von einer Epiphanie, die sie als zehnjähriges Mädchen (beim Schaukeln!) erlebte, ein „inneres Erwachen“ – „Ich wurde es, und es wurde ich“. Das bleibt die eine Grunddifferenz der beiden: Während er an Konkretem interessiert ist, beschreibt sie auch die späteren Liebesakte vor dem Hintergrund dieser geistigen Einswerdung. Der andere Unterschied ist nicht ohne Ironie: Er, der angeblich Nüchterne, verliert sich in idealisierenden Naturbeschreibungen, während sie, die mystisch Entrückte, ihre erste Liebesnacht auf einem Bett aus Exkrementen in einer dunklen Hütte erlebte und sich nicht daran störte.
Es ist der Rhythmus, die Ruhe, Rüdiger Voglers fast väterliche Neugier, aus der hin und wieder die Ahnung einer sadistischen Kälte aufscheint, und die Bodenständigkeit und messerscharfe Präzision, mit der Sylvie Rohrer sich durch die Sphären bewegt und ein Türchen nach dem anderen zum Allerheiligsten öffnet.
Zwanzig, dreißig Minuten kann man nur staunen. Aber selbst die Genauigkeit der Schauspieler kann bald nichts daran ändern, dass der exzessive Gebrauch von „je einer“, „der Atem des Anderen“ oder „salzfarbene Leere“ das Unaussprechliche nicht hervorlockt, sondern – wahrscheinlich ziemlich genervt – in die Flucht schlägt. Spätestens als die Frau dann in der Rhetorik der geistigen Liebe von den Geschlechterkämpfen der siebziger Jahre berichtet, wird es arg verschmockt, und die Exerzitien verlieren die Aufmerksamkeit des wohlwollenden Zuschauers. Oder – wie Handke wohl sagen würde – des Zeugen.
„Kabale und Liebe“ wieder am heutigen Montag und am 16. März; „Die schönen Tage von Aranjuez“ am 12. und 24. März.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false