
© dpa
Deutschlands Hauptstadt: Berlin ist die Sammelstelle der Stämme
Zwischen Halve Hahn und politischer Strategie: In Berlin gewinnen regionale Identitäten wieder an Bedeutung. Hier herrscht ein „Spiel mit Identitäten“, das dem Regionalen neue kulturelle Felder eröffnet
Mit dem Umzug der Bundespolitik von der rheinischen Residenz Bonn in die Metropole Berlin galt auch die Nachkriegszeit als beendet. Und mit ihr jener eigentümliche, stets deutlich länder- und regionalbezogene Politikstil des Adenauer-Deutschland. Denn nun ging es doch um Mut zu eigener Größe, zum Nationalen, zum Europäischen, ja, zum Kosmopolitischen. Die politische Kultur insgesamt würde sich mit und in Berlin in neuer Weise zentralisieren. Das galt unbedingt für die Politik selbst, aber auch für ihr Publikum. Zu Ende also die Zeit der „Stammespolitiker“ vom Schlage eines Franz Josef Strauß und der politischen „Regionalcharaktere“ à la Norbert Blüm oder Franz Müntefering. Zu Ende die Zeit der Besucherbusse aus den ländlichen Wahlkreisen, die manches Bonner Viertel mitunter zur Folklore- und Mundartbühne machten. Und zu Ende damit auch ein regionalpolitischer Folklorismus, dessen zentrifugale Wirkungen die westdeutschen Nachkriegsjahre und deren kleinteilige Machtarchitektur wesentlich geprägt hatten. Sogar in der so zentralistischen DDR schien nicht nur das Sächselnde einen bis ins Politbüro hinein mitschwingenden regionalen Resonanzboden zu bilden. Auch die rituell gepflegte Abneigung gegen die angeblich überversorgten Hauptstädter förderte stets sächsischen Regionalstolz und pommerschen Provinztrotz.
Alles vorbei, nur mehr Geschichte? Nein, denn auch und gerade für das Regionale gilt, dass es schon viel zu oft totgesagt wurde. Und es lebt ein gutes Jahrzehnt nach dem Regierungsumzug auch keineswegs nur in Gestalt des Seehofer’schen Komödienstadls in München weiter, der aktuell mit seiner Bayern-Maut regionale Profilbildung betreibt. Selbst die Hauptstadtszene stellt sich dem Betrachter keineswegs regional bereinigt und stammesmäßig geeint dar. Fast umgekehrt: Gerade urbane Kultur verlangt heute Vielfalt und Exotik. Und dieses Vielfaltsgebot umfasst alle „wandernden“ Kulturstile: türkische wie russische, bayerische wie schwäbische. Oder was sich jeweils dafür ausgibt. Das wiederum verbindet die Politik mit ihrem Volk: Beide kokettieren mit fremder wie eigener Exotik, die dem grauen politischen wie urbanen Alltag etwas Profil und Farbe verleiht.
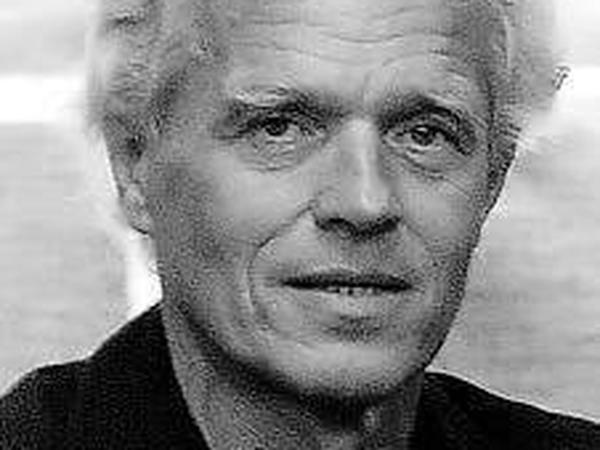
© Fot: Kai-Uwe Heinrich
So separieren sich bayerische Politiker gern im Augustiner am Gendarmenmarkt, um ihren Geburtstag bei Hellem, Weiß-Blau und Blasmusik zu feiern. Und die Rheinfraktion aller politischer Couleur wechselt nach der Sitzungswoche noch kurz vom Reichstag rüber in die Ständige Vertretung am Schiffbauerdamm, um dort bei Kölsch und Halve Hahn schon einen Vorgeschmack auf die Wochenendheimat zu bekommen. Selbst in den Bundestagsdebatten, also im politischen Kerngeschäft, sind die Verweise auf die jeweiligen Heimaten und deren „Heimstärke“ in Sachen Pisatest, Kitabetreuung, Mülltrennung oder Solarstrom nicht weniger geworden. Auch der Dialekt macht im Plenum nicht mehr nur Schwaben stolz. So feiert vielfach eine regionale „Ethnisierung“ des Politischen Urständ.
Regionaler Kampfmodus
Dass fast alle diese Beispiele mit leicht ironischem Unterton präsentiert und kommentiert werden können, unterstreicht ihre scheinbare Harmlosigkeit. Doch das könnte täuschen. Strategisch gesehen macht regionale Politfolklore durchaus neuen und ernsthaften Sinn. Und einige Gründe dafür liegen auf der Hand. Da ist zunächst die Großwetterlage des vergrößerten EU-Europa, dessen Brüsseler Bürokratie immer tiefer auch in die Belange der Länder und Regionen eingreift. Vor dem Hintergrund seiner so lange Zeit regional geprägten Geschichte und seiner heute kaum vernarbten Einheit ist dies in Deutschland immer noch ein besonders sensibler Raum. Denn dort werden im regionalen Kampfmodus eines mehr oder weniger ausgeprägten „Mia san mia“ von Berchtesgaden bis Flensburg noch viele Selbst- und Fremdbilder ausgehandelt. Bilder und Klischees, die mit Wein, Most und Bier zu tun haben können. Aber auch mit Mentalität, Stil und regionalem Ethos.
Gleichzeitig verbinden sich diese regionalen Selbstbilder heute zunehmend mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Das betrifft das gesamte gesellschaftliche Themenspektrum von Schul- und Kulturpolitik über Energie- und Ökodebatten bis zu Verkehrs- und Raumplanungen. Auffällig ist, wie sehr dabei auch Ökonomie und Ökologie zunehmend in regionalen Profilen und Strukturen betrachtet werden. Da werden Traditionsindustrien und Landschaftbilder, städtebauliches Erbe und regionaler Tourismus thematisiert und mit symbolischer Bedeutung versehen. Und die öffentlichen Debatten darüber schaffen keineswegs nur an den Stammtischen regionale Identifikations- und Mobilisierungseffekte – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Schließlich bildet natürlich auch die nach wie vor föderal-regionale Struktur des politischen Arbeits- und Karrierefeldes selbst ein wesentliches Grundmotiv. Politische Mandate und Ämter „stammen“ meist aus den lokalen und regionalen Grundheiten. Zwar muss Politik sich heute unter den Bedingungen der „Einwanderungsgesellschaft“ wie der „Europäisierung“ programmatisch deutlich weiter öffnen. In der kompetitiven Anlage der politischen Karrieremuster jedoch bleibt die individuelle Abhängigkeit von den parteilichen Orts- und Bezirksverbänden bestehen. Und die denken und delegieren personalpolitisch meist konservativ – durchaus parteiübergreifend. Zwar muss man nicht mehr im Wahlkreis geboren sein, aber man soll wenigstens so reden können. Sonst fehlen Stallgeruch und Heimatwurzel.
„Erdung“ und „Heimat“ lautet die neue urbane Botschaft von der Stadtheimat
Hinter solchen fast klassischen Erklärungen jedoch wird es deutlich komplizierter. Denn das Regionale kommt heute eben nicht mehr nur als stammesmäßiger Habitus daher. Vielmehr hat es längst neue kulturelle Dimensionen und politische Bedeutungen hinzugewonnen. So ist eine tiefe Bedeutungsverschiebung im Blick auf die Regionen selbst zu beobachten, die eben nicht mehr nur „Provinz“ verkörpern (wollen), sondern mindestens ebenso sehr „kulturelles Kapital“: für viele eine Art von Guthaben an kultureller Zugehörigkeit und sozialer Sicherheit. Und damit ist dies in der Tat ein Kapital, das sich standortabhängig auch in Form von Landschaft und Geschichte, von Ökologie und mittelständischer Industrie konkret darstellen lässt. Oder das sich in Gestalt regionaler Produkte vermarktet: Erzeugnisse aus der Region etwa ermöglichen städtischen Verbrauchern heute ökologisch nachhaltige Konsumstile, die damit „moralisch“ überlegen scheinen. Das haben auch Aldi und Edeka schon registriert.
In den Städten korrespondiert dies mit der Wiederentdeckung eigener sozialer „Grundeinheiten“. Die wiedererwachte Kölner Viertel- oder Berliner Kiezkultur etwa wirkt wie eine Nobilitierung des Lokalen und Regionalen. Und sie vermittelt den Bewohnern generell und den Politikern speziell das Gefühl wie den Anschein von „Erdung“ und „Heimat“. So jedenfalls lautet die neue urbane Botschaft von der Stadtheimat.
Bestätigt werden diese Umwertungen auch durch die Rückkehr des regionalen Dialekts. Ob in den TV-Vorabendserien, in den Rap-Songs der Jugendkulturen oder auf wissenschaftlichen Tagungen des Schweizer Nationalfonds: Vieles ist dort für Dialektunkundige ohne Untertitelung kaum mehr verständlich. Dies aber – und das macht den Unterschied aus – ist heute offenkundig allein deren Problem, nicht mehr das der früher vermeintlich rückständigen Dialektsprecher. Jenes „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ hat insofern nur werbeförmig nachvollzogen, was lebensweltlich längst wieder Realität geworden war.
Auch gehört die Region heute offenbar und anders als früher nicht mehr automatisch zu jener „biodeutschen“ Landschaft der Gestrigen. Sie emanzipiert sich vielmehr dadurch vom Nationalen, dass auch sie selbst nun vielschichtig und vieldeutig daherkommt. Nicht mehr nur als uriges regionales Mentalitätskollektiv, sondern zunehmend auch als plurale und fein differenzierte Charakterlandschaft. Hier werden offenbar die gesellschaftlichen Veränderungen von Arbeitsmärkten und Lebensstilen, von Religiositäten und Esskulturen auch in den Nahräumen wirksam und sichtbar. Es hängt aber wohl auch mit neuen Ambivalenzen des Nationalen wie des Europäischen zusammen, das ja einerseits gerne als das Andere, Große, Ferne „verfremdet“ wird. Vor allem dann, wenn von Brüssel aus versucht wird, die Rezeptur französische Käsesorten oder das Reinheitsgebot deutschen Bieres zu „hygienisieren“. Andererseits wird dasselbe EU-Europa umgekehrt wieder zum Nahen, quasi zur Heimatregion, wenn es für Grundsätze der Sozialpolitik oder der Ökologie eintritt. Unausgesprochen natürlich auch, wenn es sich als kontinentales Grenzregime gegen unerwünschte Flüchtlinge abschottet. Und ausgesprochen gerne dann, wenn die amerikanische NSA „uns Europäer“ datenmäßig auszuspionieren versucht: unsere kleine, feine „Weltregion“.
Regionaler Habitus als "kulturelles Mandat"
Diese durchaus unvollständige Aufzählung mag verdeutlichen, wie sehr das Regionale in den vergangenen Jahren zu einer zentralen Repräsentationsstrategie im gesellschaftlichen wie politischen Raum geworden ist. Und dies meint eben keineswegs nur alte politische Folklore. Vielmehr hilft der regionale Bezug ganz wesentlich bei der Legitimierung von politischen Interessen wie bei der Authentisierung von politischen Biografien. Region, Dialekt, Landschaft: Das assoziiert Echtheit, Verwurzelung, Nachhaltigkeit, eben „authentische“ Qualitäten. Und die gehören – wieder – zum symbolischen Kapital eines bestimmten Politik- wie Politikertypus. Nicht wenige aktive Mitglieder des politischen Spitzenpersonals in Berlin könnten sich ohne ihren spezifischen regionalen Habitus wohl kaum erfolgreich darstellen. Ihnen verschafft ihre regionale Performance offenbar ein besonderes Karrierekapital, eine Art „kulturelles Mandat“.
Allerdings hat dieses Regionale heute eben seine Ausschließlichkeit endgültig verloren. Es ist nur mehr eine von vielen Optionen der sozialen wie politischen Selbstverortung. Und es kommt nicht mehr wie früher als ein festes Set von Stammeseigenschaften daher, zu denen Herkunft, Mentalität und Religion ebenso zählten wie Ess- oder Musikgeschmack. Regionalität hat heute längst ihre enge Raumbindung verloren, wenn Maultaschen und Brezeln in Berlin ebenso eingemeindet sind wie der Döner in Tübingen oder das Heringsbrötchen in Leipzig. Der Regionalmensch kann auch als Bayer oder Pfälzer „an sich“ durchaus Atheist, Blasmusik-Hasser und BVB-Fan sein, ohne deshalb gleich exkommuniziert zu werden. So wird der Schwäbisch-Türkisch-Muslimisch- Grüne Cem Özdemir trotz und wegen all seiner unklaren und vermischten Identitäten schon seit Jahren wie ein regionales Maskottchen des politischen Südwestens behandelt. Und er erträgt dieses Schicksal offenbar auch deshalb geduldig, weil er weiß, dass er damit umgekehrt so manches schwäbisch-christliche Selbstbild irritiert. Migration und Mobilität schreiben sich eben tief auch in regionale Repräsentationen und Texturen ein.
„Schrippen“ oder „Weckle“
Offenbar ist es also auch ein „Spiel mit Identitäten“, das dem Regionalen heute neue kulturelle Felder eröffnet und neue politische Züge ermöglicht. Das wiederum verbindet die Politiker mit uns allen: die Erfahrung der permanenten kulturellen Veränderung unserer Berufsalltage wie Lebenswelten. Und dies steckt offensichtlich auch hinter Schweizer Diskussionen über eine „Verdeutschung“ ihre Kliniken und Universitäten wie hinter der medial so beliebten Berliner „Schwabenjagd“. Dabei geht es gewiss auch um Jobs und Mieten. Aber zunächst und vor allem geht es dabei um soziale Zuordnungen und kulturelle Abgrenzungen. Wir versuchen einfach immer wieder, kleine und pragmatische Differenzkonstruktionen von „Wir und Die“ zu produzieren, um unseren Alltag übersichtlich und versichernd zu gestalten. Und ein nicht allzu ernst gemeintes Freund-Feind- Schema hilft dabei ungemein. Regionale Performance ist also auch schon Bestandteil des urbanen Kulturgemenges. Auf dieser Ebene bewegte sich denn offenbar auch Wolfgang Thierses öffentlich geäußerter Wunsch, „Schrippen“ in Berlin nicht als „Weckle“ zu misshandeln.
Immerhin: Zur Berliner Schwabenjagd ist nun in Dresden der ultimative Kommentar nachzulesen. Dort fordert ein Mauergraffito: „Schwaben zurück nach Berlin!“ So scheint nun endlich auch für diesen Stamm doch noch eine regionale Vision von Heimat auf.
Wolfgang Kaschuba
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false