
© AFP
Countdown zur US-Wahl: Noch 14 Tage: TV-Duell: Obama griff an, Romney spielte Präsident
Ruhig, resolut und kenntnisreich hat Mitt Romney Barack Obama in einen Rollentausch gedrängt. Die letzte TV-Debatte dürfte die Dynamik des Wahlkampfes kaum verändern - davon allerdings profitiert Romney.
Nanu, wer spricht denn da? „Wir wollen einen friedlichen Planeten.“ – „Wir wollen starke Verbündete.“ – „Krieg darf immer nur das letzte Mittel sein.“ – „Wir kommen aus dem Schlamassel nicht durch weiteres Töten heraus.“ – „Ich will mehr Frieden, Menschenrechte und Menschenwürde verteidigen.“
Ja, genau, das sagt Mitt Romney, jener konservative, knallharte Wiedererwecker der neokonservativen Interventions-Ideologie, der die Welt in Gut und Böse scheidet und die Kriegstrommeln gen Teheran schlägt. Doch von diesem Romney war am Montagabend in der Lynn University in Boca Raton nichts zu sehen und zu hören. Wieder einmal zeigte sich der Republikaner als schamloser Meister in der Kunst, negative Zerrbilder von sich in weichgezeichnete David-Hamilton-Poster zu verwandeln. Bei jedem zweiten Romney-Satz fühlte man sich an die Kandidatinnen im Schönheitswettbewerb aus dem Film „Miss Congeniality“ erinnert, die reflexartig auf die Frage, was sie sich am meisten wünschen, „Weltfrieden“ antworten.
Folglich saß da ein fast verzweifelt wirkender Präsident, der immer wieder versuchte, den Gegensatz zwischen klugem Diplomaten (er selbst) und unberechenbarem Rambo (Romney) zu inszenieren. Doch das klappte nicht. Stoisch lächelte sich der Herausforderer durch jede Attacke hindurch. Barack Obama stieß auf den Widerstand eines glitschigen Aals, der sich jedem Zugriff entwand.
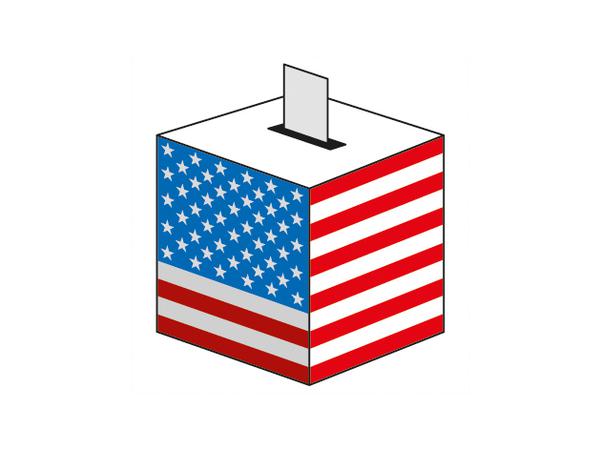
© Tsp
Obama griff an, Romney spielte Präsident. Ruhig, resolut und durchaus kenntnisreich hatte er den Amtsinhaber in einen Rollentausch gedrängt. Als dieser ihm rhetorisch gekonnt vorhielt, eine Außenpolitik der achtziger Jahre zu verfolgen, eine Sozialpolitik der fünfziger Jahre und eine Wirtschaftspolitik der zwanziger Jahre, entgegnete Romney nur: „Mich anzugreifen, ist noch kein Programm.“ Damit verstärkte er den Eindruck, Obama sei der ewige Mahner, Warner und Miesmacher, während er, Romney, über allem Zwist schwebt und lieber Amerika als Nation definiert, „die die Hoffnung der Erde verkörpert“.
Was also wollen die beiden? Raus aus Afghanistan, keine US-Intervention in Syrien, den Iran möglichst durch Sanktionen von der Atombombe abbringen, Drohneneinsätze fortführen, kritische, aber nicht feindliche Distanz zu China halten, allerengste Beziehungen zu Israel unterhalten (Ich bin enger! Nein, ich bin enger! Nein, ich bin enger!)

© Tsp
Was die TV-Debatte belegt: Weniger denn je erklärt sich Amerikas gegenwärtige Außenpolitik durch besondere ideologische Momente als durch emotionale und pekuniäre Faktoren: Nach zwei aufwändigen und nicht gerade glorreich verlaufenen Kriegen ist der Weltpolizist der Interventionen müde geworden, außerdem fehlt ihm das Geld, ganz verzichten auf den globalen Lenkungsanspruch möchte er trotzdem nicht. Der einzige Unterschied zwischen Obama und Romney: Während der Präsident erst einmal die Uniformen flicken möchte („nation building at home“), will der Herausforderer das Megaphon reparieren („policy of strength“).
Die Dynamik des Wahlkampfes dürfte dieses letzte TV-Duell, das keins war, kaum verändern. Davon allerdings profitiert Romney. Ihm ist es in den vergangenen Wochen gelungen, den Igitt-Stempel, der ihm aufgedrückt worden war, verblassen zu lassen. Aus dem schnöseligen, eiskalten Hedgefonds-Manager, dem unsozialen, verblendeten Rechtsausleger und außenpolitischen Ignoranten ist ein Kandidat geworden, dessen sich kein Sympathisant mehr schämen muss. Die Grusel-Strategie der Demokraten – Obama mag seine Schwächen haben, aber Romney ist gefährlich – verfängt nicht länger.
In genau 14 Tagen wird gewählt. Für Obama sprechen die gesellschaftlichen sozio-kulturellen Trends - zunehmende Toleranz etwa in Bezug auf Homo-Ehe, noch größeres Gewicht der Einwanderer, Lockerung der kirchlichen Bindungen, anhaltender Überdruss an jeder Art von Bush-Revival. Für Romney sprechen die Geschlossenheit und Motivation der Republikaner sowie die relativ miserable Wirtschaftslage und immer noch hohe Arbeitslosenquote. Außerdem spricht für Obama, dass er nicht Romney ist. Aber inzwischen spricht auch für Romney, dass er nicht Obama ist.
Fingernägel knabbern nützt nichts. Es bleibt spannend.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false