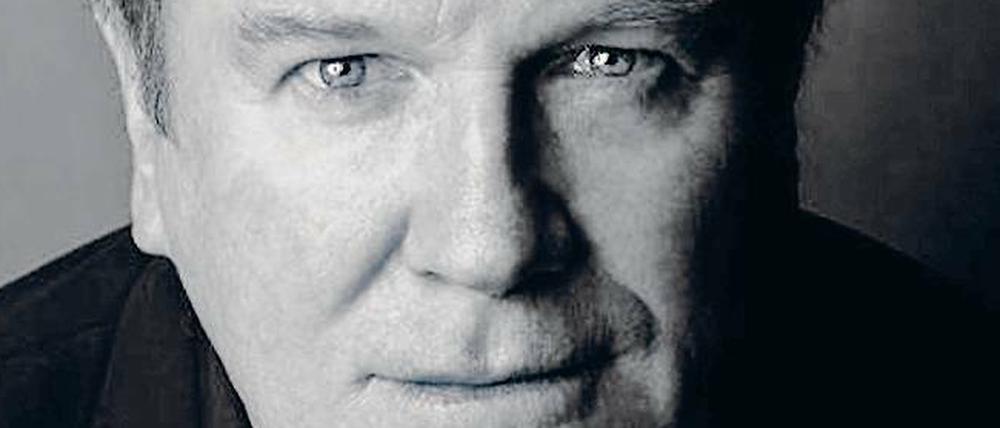
© Trevor Leighton
Autor William Boyd: „James Bond macht dumme Fehler“
William Boyd hat den Agenten 007 genau seziert – und dann wiederbelebt. Er weiß auch, wie Prinz Charles gequält wurde und hasst Sterneköche.
- Andreas Austilat
- Ulf Lippitz
Mr. Boyd, schön haben Sie es hier in Chelsea. James Bond soll gleich um die Ecke gewohnt haben.
Ja, am Wellington Square. Niemand weiß, welches Haus Ian Fleming beim Schreiben im Kopf hatte, aber ich habe zur Recherche alle zwölf Romane und acht Kurzgeschichten gelesen, jedes Detail notiert. Da kam keine andere Adresse infrage.
Sie hätten eine erfinden können.
Wenn ich geschrieben hätte, Bond hat ein Haus in Hampstead, würden mich sofort 1000 aufgebrachte Leser bestürmen. Dass er nun mein Nachbar wurde, ist Zufall. Ich wohne hier seit 25 Jahren und wusste das nicht.
Weil Sie sich, bevor Sie diesen Job übernahmen, nicht für Bond interessiert haben?
Zuerst habe ich mich für Ian Fleming als Person interessiert. Der hatte ein kompliziertes Verhältnis zu dem Schriftsteller Evelyn Waugh, den ich sehr schätze. Die beiden kannten, aber mochten sich nicht. Dabei waren sie typische englische Autoren ihrer Zeit – Misanthropen, die so schnell wie möglich sterben wollten. Fleming und Waugh begingen eine Art langsamen Selbstmord.
Beide tranken zu viel.
Fleming rauchte drei Schachteln Zigaretten pro Tag und trank eineinhalb Flaschen harten Alkohol. Beide nahmen verschreibungspflichtige Tabletten, morgens, um in Gang zu kommen, und abends, um besser einschlafen zu können. Sie waren depressiv. Flemings Frau Anne schrieb an Waugh: „Ian sitzt den ganzen Tag in seinem Schlafzimmer, er starrt aus dem Fenster – ein Zustand schieren Elends.“ Waugh und Fleming waren privilegierte Mitglieder der Oberklasse, denen ihr Butler das Frühstück brachte, sie zur Bibliothek fuhr, jeden Handschlag abnahm. Sie schrieben aus reiner Langeweile. Hätten sie Antidepressiva genommen, wären sie vielleicht älter geworden.
Welche Drogen nehmen Sie?
Ich mag Drinks, aber ich bekomme einen furchtbaren Kater am nächsten Tag.
Und was hat Sie getrieben, einen James-Bond-Thriller zu schreiben?
Mich interessiert die Psychologie von Agenten, die in einem Punkt Schriftstellern ähneln: Beide handeln mit Lügen. Als Schreiber inspiziere ich meine Umgebung genauso, wie es ein Spion tun würde. Was ist das für ein Kleid? Hält der Mann seine Zigarette komisch? Wie ein Spion, der niemals entspannt, einen Raum betritt und nach dem besten Fluchtweg Ausschau hält. Das habe ich in meinen Spionageromanen „Ruhelos“ und „Eines Menschen Herz“ bereits beschrieben. In letzterem tritt Ian Fleming sogar kurz auf.
Deshalb schickte die Fleming-Familie eine E-Mail: Mr Boyd, hätten Sie Lust, einen Bond zu schreiben?
Nein, mein Agent rief mich an. Er sagte, rate mal, von wem ich eine Anfrage auf dem Tisch habe. Ich sagte sofort zu. Dann erst traf ich die Familie.
Warum das Buch niemals verfilmt wird
Auch die des Filmproduzenten Albert Broccoli?
Nein. Ian Fleming geriet am Ende seines Lebens in finanzielle Schwierigkeiten. Er verkaufte die Filmrechte seiner Figuren an Albert Broccoli und Albert Sultzman. Deren Firma ist die einzige, die einen Bond-Film aus meiner Geschichte machen dürfte. Was jedoch nicht passieren wird.
Warum nicht?
Sie müssten ihren zeitgenössischen Bond aufgeben, um einen historischen Film zu drehen. Mein Roman spielt ja 1969.
Man könnte ihn in die Gegenwart versetzen.
Nur müssten Sie Handys, Satelliten-Tracking und mobile Überwachung hineinschreiben, und meine Story würde an Reiz verlieren. Erinnern Sie sich an den letzten 007-Film „Skyfall“? In einer Szene sieht man die Grabsteine von Bonds Eltern. Da stehen keine Jahreszahlen darauf. Warum? Weil sie 1933 gestorben sind. Und das würde bedeuten, Bond wäre heute 88. Das geht nicht.
Der Bond aus den Filmen hat mit dem aus den Büchern nichts zu tun?
Vergessen Sie Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig! James Bond macht dumme Fehler. Etwa im Buch „Man lebt nur zweimal“. Da gibt er sich als tauben japanischen Fischer aus und lässt sich seine echten Papiere stehlen. Ein Geheimagent wird von einem Taschendieb ausgetrickst!
Er ist menschlicher, als wir ahnten.
Bond weint oft. Wenn er eine entstellte Leiche sieht, übergibt er sich. Er fliegt nicht gern. Die Familie wollte mir das nicht glauben. Da habe ich ihnen „Liebesgrüße aus Moskau“ empfohlen. Fleming beschreibt über zwei Seiten, wie Bond hysterisch wird, als er von London nach Istanbul muss.
Hysterisch, das ist doch die Rolle der Bond-Girls?
Der Flug dauert ewig, weil damals die Maschinen zum Auftanken zwischenlandeten. Bond fliegt zuerst nach Rom, dort trinkt er zur Beruhigung zwei Americanos, das ist ein Campari mit süßem Wermut, dann geht es weiter nach Athen, wo er zwei Ouzos bestellt, und auf dem Weiterflug nach Istanbul kippt er sich zwei Dry Martinis und eine halbe Flasche Rotwein hinter. Bei der Ankunft muss er komplett betrunken gewesen sein. Irgendwo gibt es von Fleming diesen schönen Satz: „Der dreizehnte Whiskey war ein großer Fehler.“ Und noch einer: „Bond zündete sich die 70. Zigarette an.“ Er raucht wie ein Schlot.
Rauchen und Trinken waren sozial akzeptiert.
Nicht nur Fleming und Evelyn Waugh, auch Scott Fitzgerald, Hemingway, alle waren Alkoholiker. Niemand dachte, dass es etwas Schlimmes sei. Mein Vater leitete in den 60er Jahren eine Klinik in Nigeria, wo wir damals lebten. Wenn er zum Mittagessen kam, trank er als Erstes zwei Pink Gins.
Sie haben einmal gesagt, Sie fühlten sich in Ihrer Kindheit oft als Außenseiter.
Als weißer Junge in Afrika war ich ein Außenseiter. Trotzdem war es mein Zuhause, ich kannte Ghana und dann Nigeria besser als England. Als ich nach Großbritannien aufs Internat musste, fühlte ich mich lange, als ob ich zu Besuch wäre.
Sie lebten in einer betuchten Kolonialfamilie.
Mein Vater hatte die Verantwortung für die Gesundheit von 30 000 bis 40 000 Leuten. Das war ein Riesenbetrieb, Studenten, Stab, medizinisches Personal. Wir wohnten in einem wunderschönen Haus, hatten einen Koch, einen Boy, Nannies.
Und dann zogen Sie Ende der 60er Jahre zurück ...
In Schottland waren wir plötzlich einfache Mittelschicht, lebten in einem Mietshaus, hatten keinen Koch mehr, meine Mutter musste diese Arbeiten übernehmen, sie war nun eine normale Hausfrau.
Was er im Internat erlebte
Zu der Zeit mussten Sie ins Internat. Wie war das?
Ich war in Gordonstoun. Wir machten unsere Betten, wischten die Fußböden und reinigten die Zimmer. Es war zwar eine Privatschule, aber kein leichtes Leben.
Prinz Charles war zur selben Zeit Schüler dort.
Er war ein paar Klassen über mir – und er hasste es. Ich habe ihn später bei irgendwelchen Anlässen getroffen. Wir unterhielten uns über die Lehrer, die wir kannten, die Häuser, in denen wir wohnten. Er wurde schikaniert, auch physisch.
In einer englischen Zeitung hieß es, er sei dort mit einer Kneifzange gequält worden. Sie auch?
Ich war gut in Sport und relativ beliebt. Aber es stimmt, der Schriftsteller W. H. Auden hat einmal gesagt, jeder englische Schuljunge versteht den Faschismus, weil er als Schüler unter einem faschistischen Regime gelebt hat. In meinen ersten beiden Jahren, mit 13, war unser Internat ein wirklich gefährlicher Ort. Es gab Senior Boys, die einen aus dem geringsten Anlass quälten.
Zum Beispiel?
Wenn ein Senior einen Jüngeren beim Rauchen erwischte. Er wurde ausgezogen, sein Schamhaar rasiert, und die älteren Jungs rieben seine Genitalien mit Zahnpasta ein. Hinzu kommt der Snobismus. Die privilegierten Jungs hegen große Verachtung gegenüber Angehörigen niedrigerer Schichten, es gibt haarsträubende Auswüchse von Klassenhass. Es reichte, einen Akzent zu haben. Wir hatten Griechen, junge Iraner, die wurden massiv gemobbt. Wenn einer schwarz war, hörte er jedes vorstellbare rassistische Schimpfwort.
Die Lehrer haben das nicht mitgekriegt?
Weil niemand darüber sprach, das hätte es nur schlimmer gemacht. An der Oberfläche sieht es nach einer glücklichen, ausgeglichenen Gesellschaft aus. Aber darunter ist das ein Treibhaus.
Glauben Sie, das ist überall in Internaten so?
Ich kann nur für britische Schulen sprechen. Unglücklicherweise wird unser Land von einer Elite dominiert, die selbst auf Privatschulen ging. Unter fünf Prozent besuchen diese Schulen, aber ihr Einfluss ist vollkommen überproportional.
In Deutschland waren weder Gerhard Schröder noch Angela Merkel Privatschüler.
Großbritannien ist vergleichbar mit Frankreich. Eine Plutokratie, die durch Geld in ihre Schlüsselposition kommt. Schauen Sie auf unsere Politiker, alles ehemalige Privatschüler, die Richter, der höhere öffentliche Dienst. Das war in Flemings Zeiten schon so. Gehen Sie mal in einen Gentlemen’s Club, das ist wie eine Zeitreise.
Ein Feinschmecker ohne Führerschein
Eine Zeitreise haben Sie für die Recherche Ihres Buches gemacht: in das London von 1969.
Das kannte ich aus persönlichen Erfahrungen. Ich war 17, hatte eine Freundin und ging in Diskotheken. In jenem Sommer hatte ich eine kleine dreckige Wohnung in Pimlico. Ich erinnere mich, dass ich dort die Mondlandung verfolgt habe.
Das Lied des Sommers war?
Stevie Wonder, „My Cherie Amour“. Wenn ich das höre, sehe ich mich, wie ich durch das sonnige Pimlico laufe, an Autowerkstätten vorbei, in denen Mechaniker an den Wagen schraubten und das Lied laut aufdrehten. Es war schon eine große Zeit, am Leben zu sein. Ich bin einmal mit einem Freund nach Saint Tropez getrampt, weil dort die Mädchen keine Bikinioberteile trugen. Wir verbrachten zwei Wochen dort, zwei arme Jungs am Strand, Baguettes und Bierflaschen in der Hand, die den Leuten hinterherstarrten.
Heute sind Sie wohlhabend und können sich mit einem teuren Auto belohnen wie James Bond?
Ich kann nicht fahren. Zum Glück bin ich mit einer Frau verheiratet, die einen Führerschein hat. Ich habe nie außergewöhnlich viel Geld für Dinge ausgegeben. Schauen Sie sich meine Uhr an …
… die hat ja nicht einmal ein Armband ...
... kaputt, war aus Plastik, das ist ein ganz billiges Teil. Ich habe mir für das Bond-Buch einen neuen Anzug gekauft, weil ich auf Lesereise gehen muss.
Aber als Nachfolger von Fleming müssen Sie ein Auge für Luxus haben.
Richtig. Ich konnte nicht schreiben, sie trägt ein blaues Kleid, sondern eines aus Shantung-Seide. Dafür habe ich Frauen-Zeitschriften gekauft, faszinierend, hier habe ich zum Beispiel eine „Vogue“ vom März 1969. Hat damals vier Shilling gekostet, im Internet habe ich 15 Pfund bezahlt.
Hat dieser ganze Lifestyle denn gar nichts mit Ihnen als Mensch zu tun?
Ich bin wie 007 ein Feinschmecker. Meine Frau Susan kocht gut, ich bin derjenige, der schneidet und filettiert. Ich achte darauf, was ich esse, und bin ziemlich weit von den Rühreiern entfernt, die Bond jeden Tag zum Frühstück isst. Das heißt nicht, dass ich dauernd in Sternerestaurants einkehre. Kennen Sie Gordon Ramsey, den englischen Spitzenkoch? Sein Restaurant ist nur zwei Straßen weiter. Ich hasse dieses Essen.
Warum?
Weil es mir zu fusselig ist, hier ein Tropfen, da ein Tropfen, ich mag einfache bürgerliche Küche, französisch inspiriert oder italienisch. Die besten Zutaten einfach zubereitet. Gestern Abend haben wir einen Kabeljau in sehr gutem Olivenöl gedünstet, dazu gab es italienische Kartoffeln, Tomaten und eine Menge Kräuter, die wir in unserem winzigen Terrassengarten hier hinter dem Haus anpflanzen. Das hat nichts mit High-End-Küche zu tun.
Haben Sie sich nie was Extravagantes geleistet?
Ich habe einmal einen schmalen Gedichtband von Philip Larkin gekauft. Eine Erstausgabe, die hatte nur 20 Seiten und hat mich 1000 Pfund gekostet. Als er anfing, Gedichte zu schreiben, das muss noch in den 1940er Jahren gewesen sein, war er Bibliothekar in Belfast. Von diesem Band gibt es nur 200 Stück. Ich habe ihn vor 25 Jahren gekauft, wahrscheinlich ist er heute 10 000 Pfund wert.
Sind Sie vorsichtig im Umgang mit Geld?
Ich bin Schotte, wir sind Pfennigfuchser. Als Freiberufler muss ich aufpassen. Zwei Monate können vergehen, in denen ich kein Geld verdiene. Und dann kommt ein ganzer Batzen. Wie es mit „Unser Mann in Afrika“ passiert ist, meinem ersten Roman von 1981, einer Geschichte über einen Arzt in einem westafrikanischen Land. Der wurde 1994 ein Hollywoodstreifen mit Sean Connery. Und nur, weil Sean sagte: Ich mache den Film.
Sie nennen ihn Sean – von Schotte zu Schotte?
Wir sind Teil der Scotia Nostra, der schottischen Mafia. Nein, ich habe ihn einige Male getroffen, er las das Drehbuch, seitdem kennen wir uns.
Sein Freund und Schauspielerkollege Michael Caine hat behauptet, es sei angenehmer, in eine Schlägerei in einem Londoner Pub verwickelt zu sein, als einem Wutausbruch von Sean Connery beizuwohnen.
Ich habe nur einen erlebt. Wir drehten eine Szene auf einem Golfplatz nahe einem Flughafen. Sean fing an zu spielen, der Tontechniker rief: Stopp, stopp, ein Flugzeug. Zweiter Versuch. Wieder rief der Techniker: Stopp, Flugzeug. Beim dritten Mal ging Sean zu ihm, schrie „What the fuck are you doing?“ und nahm ihn auseinander. Der Tontechniker sagte nie mehr ein Wort. Trotzdem ein toller Kerl. Als ich 1999 auf dem Edinburgh Filmfestival meinen Film „The Trench“ vorstellte, kam er zur Premiere. Es war, als wäre der König Schottlands zu uns herabgestiegen. Die jungen Schauspieler drückten ihm ehrfürchtig die Hand.
Unter ihnen Ihr damaliger Hauptdarsteller Daniel Craig, heute 007. Wäre er passend für Ihr Buch?
Fleming schreibt, Bond sieht aus wie der amerikanische Sänger Hoagy Carmichael. Kennen Sie nicht? 1958 wusste jeder, wie der aussieht. Ein gut aussehender Typ, schlank, groß, dunkel, könnte auch Italiener sein. Daniel Day-Lewis wäre gut für die Rolle. Er passt zu dem 007 aus den Büchern.
Stimmt es, dass Sie nach dem Bond nun keine Spionagegeschichten mehr schreiben wollen?
Ach, wissen Sie: Sag niemals nie.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false