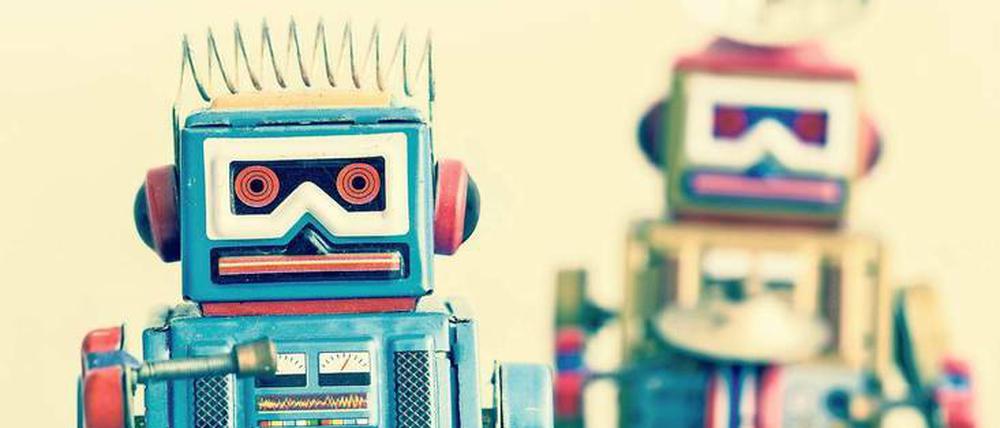
© Getty Images/iStockphoto
Künstliche Intelligenz aus Berlin: Dürfen wir vorstellen: Kollege Roboter
Künstliche Intelligenz rettet Leben und automatisiert langweilige, monotone Arbeiten. Unsere Autorin hat zwei Berliner Firmen besucht, deren Produkte die Welt verändern könnten.
Die Firma Xbird verspricht, woran Hellseher und Wahrsager seit Jahrtausenden gescheitert sind: einen Blick in die Zukunft. Mit der Smartphone-App der Berliner soll künftig jeder herausfinden können, ob ihm eine schwere Erkrankungen droht. Mit Glaskugeln und anderem Hokuspokus allerdings hat das nichts zu tun, sondern vielmehr mit der konsequenten, erfolgreichen Auswertung von Daten. Wie das geht, führt Xbird-Geschäftsführer Markus Knoke bei einem Unternehmensbesuch vor. Egal ob er hüpft, springt, klatscht oder läuft: Seine Armbanduhr nimmt jede seiner Bewegungen wahr und sendet die Informationen an das Telefon.
Digitales Tagebuch für Diabetiker
Die Technik soll schon bald Diabetikern zu einem angenehmeren, lebenswerteren Alltag verhelfen. Denn die verschiedenen Bewegungsarten erfasst die App ebenso wie Mahlzeiten, die sie an der schaufelnden Armbewegung erkennt, und speist sie gemeinsam mit Daten zu Blutzucker und Insulinlevel in eine App ein. Hat der Patient die Sensoren unter der Haut oder überträgt sein Messgerät die Daten an die App, muss er nicht einmal mehr eingeben, was er gegessen hat oder wie hoch seine Werte waren – bisher eine tägliche Mühe für Diabetespatienten, die noch dazu fehleranfällig ist. „Der erste Schritt besteht darin, dass wir den Ärzten ein automatisch erstelltes Tagebuch für ihre Diabetespatienten an die Hand geben wollen“, erklärt Knoke. „Im zweiten Schritt wollen wir in der Lage sein, Ereignisse wie zu Unterzuckerung voraussagen zu können.“
All das wird möglich durch künstliche Intelligenz, kurz: „KI“. Denn wie ein Patient auf verschiedene Ereignisse wie Sport, ein Glas Bier, einen Salat oder Schlafmangel reagiert, ist höchst individuell; eine einfache Formel gibt es nicht. Deswegen müssen die Algorithmen bei jedem Fall aufs Neue lernen, welche Verhaltensweisen womöglich zu Unterzucker oder zu hohen Blutzuckerleveln führen könnten.

© promo
Unbegründete Ängste
Doch was genau ist das überhaupt, künstliche Intelligenz? Wer an sprechende, menschenähnliche oder gar menschengleiche Roboter denkt, liegt zwar nicht komplett falsch. Sogenannte „starke“ KI ahmt in der Tat den Menschen in all seinen Eigenschaften nach, erklärt Aljoscha Burchard vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Sein Institut betreibt seit dreißig Jahren Forschung im Gebiet der künstlichen Intelligenz.
Er beobachtet einen Durchbruch in diesem Gebiet, nicht zuletzt bedingt durch die besseren Datenverarbeitungsmöglichkeiten und schnelleren Prozessoren, die in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind. Das Ende der Fahnenstange ist für ihn aber noch lange nicht erreicht. „Das, was Menschen aus Daten rausholen können, ist wirklich toll“, sagt er. „Aber das sind eigentlich die niedrig hängenden Früchte.“
Die „starke“ KI macht allerdings den kleinsten Teil der KI-Forschung und -Anwendung aus. „Es geht um einzelne Aufgaben, die die Maschine übernehmen und vielleicht besser machen kann“, erklärt Christian Hammel vom Berliner Institut für Technologieforschung. Oder man geht sogar noch weiter und stellt dem Algorithmus ganz neue Aufgaben, so wie die Xbird-App, die eben nicht nur messen und analysieren, sondern auch vorhersagen und warnen soll.
Oder das Forschungsprojekt, das das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zusammen mit der Deutschen Bahn durchgeführt hat: Verschiedenste Datenquellen wie Fahrpläne, Karten, Nachrichten und Tweets wurden von einer künstlichen Intelligenz ausgelesen und erzeugten so Verkehrsmeldungen. Aus einer Unfallmeldung vom Hardenbergplatz und dem Tweet eines gestrandeten Pendlers am Bahnhof Zoo könnte der Algorithmus so blitzschnell kombinieren: Aha, hier gibt es eine Störung!
Der nächste Schritt wäre dann eine Meldung an den Kunden, der die Nachricht schneller bekommen würde, als wenn ein Servicestellenmitarbeiter sie überprüfen und erstellen müsste. Der könnte zudem niemals den Überblick über so viele Informationsquellen behalten wie ein digitales Gehirn. Trotzdem treffen KI-Pioniere immer wieder auf Vorbehalte: Alle Gesprächspartner sprächen die Themen Datensicherheit und ihre Sorge, durch Roboter ersetzt zu werden, an. „Alleine der Name weckt schon Ängste“, sagt Aljoscha Burchard.
Technik in den Kinderschuhen
Andererseits beobachten Szene-Insider einen Hype um KI und eine inflationäre Verwendung des Etiketts: „Manche meinen, KI sei wie Ketchup: Wenn man es drüberkippt, wird alles besser“, scherzt Sebastian Sujka, einer der drei Xbird-Mitgründer, über die Mentalität vor allem der alteingesessenen mittelständischen und großen Firmen.
Auch Forscher Christian Hammel hat das beobachtet: „Es geistern schon eigenartige Vorstellung von KI herum“, sagt er. „Da sprechen Firmen von KI, wenn sie gerade mal etwas maschinelles Lernen betreiben.“ Hammel arbeitet momentan an einer Studie über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die Berliner Wirtschaft. Zahlen sind noch nicht druckreif, aber eine Beobachtung lässt sich bereits machen: „Es ist sehr breit gestreut, wo KI zum Einsatz kommt, und es kommt kaum eine Firma drum herum.“
Das liegt auch daran, dass KI keine Industrie für sich ist, sondern eine Querschnitttechnologie, die eine weite Spanne an Unternehmen umfasst – von der Automobil- über die Tourismusindustrie bis hin zum Sicherheitssektor. Gemeinsam haben die Unternehmen eigentlich nur eines: Sie sind allesamt sehr jung. „Erst in den vergangenen vier oder fünf Jahren hat sich etwas getan“, sagt Xbird-Geschäftsführer Sebastian Sujka. Xbird dringt seinerseits mit seinem Produkt in eine Branche, in die sich bislang nur wenig KI-Start-ups vorgewagt haben. Im Medizintechnikbereich nämlich sind die technischen und regulatorischen Anforderungen im Vergleich zu anderen Branchen sehr hoch.
Empathie ist nicht gefragt
Ein gutes Beispiel für eine KI-Anwendung, die bestehende Prozesse aufgreift und automatisiert, ist das Programm von Parlamind, einem Start-up aus Prenzlauer Berg, das den Kundenservice vereinfachen will. „Nur 40 Prozent der Kundenanfragen sind so individuell, dass sie menschliche Empathie und Kreativität verlangen“, sagt Tina Klüwer, Mitgründerin von Parlamind. In den restlichen Fällen möchte der Kunde einfach eine Frage beantwortet haben. Dann kann die Software entweder eine vorgefertigte Antwort geben oder sogar auf Drittsysteme zugreifen. Will der Kunde etwa wissen, wo denn nun das Postpaket abbleibt, greift das Programm auf die Tracking-Datenbank zu – so sie denn die Erlaubnis hat – und schickt dem Kunden den Link zur Verfolgung des Pakets zu.

© promo
Das hat laut Klüwer nicht nur den Vorteil, dass das Unternehmen Ressourcen einspart. „Es ist nicht unser Ziel, den Menschen hundertprozentig zu ersetzen“, stellt sie klar. Sie sieht ihren Beitrag eher in einer Entlastung der Servicemitarbeiter, denn viele Unternehmen versuchen bereits, Kosten zu senken und Anfragen zu vermeiden, indem sie etwa die Mailanfrage oder den Anruf erst dann zulassen, wenn sich der Kunde durch endlose FAQ-Menüs geklickt hat. Viele Fragen sind dennoch die immergleichen. „Es ist repetitive Arbeit, es ist langweilig und deswegen entsteht Fluktuation.“
Berlin als Spielewiese
Aber auch die Start-ups haben Probleme beim Anwerben von Mitarbeitern, selbst wenn die Aufgaben hier neu und spannend sind: Der Fachkräftemangel in der IT-Branche macht auch den Berliner Start-ups zu schaffen, zumal es kaum Studiengänge mit KI-relevanten Profilen oder Forschungsinstitute neben dem DFKI gibt – dort sind München und Karlsruhe die Vorreiter. Deswegen ist die Verkehrssprache sowohl bei Parlamind als auch bei Xbird Englisch, die jungen Programmierer kommen hauptsächlich aus dem EU-Ausland. „Für Berlin spricht, dass die Leute gerne herkommen“, sagt Klüwer. Xbird-Chef Sebastian Sujka sieht es ähnlich: „Berlin ist besser als Sindelfingen, aber nicht so gut wie San Francisco.“ Damit meint er auch, dass viele seiner potenziellen Kunden nicht in Deutschland ansässig sind und dass das Kapital etwa in den USA großzügiger fließt.
Ein Vorteil Berlins ist aber sein Ruf als Spielwiese für Freigeister: Von Sujkas Münchener Kollegen gründete niemand, nur diejenigen, die schon immer unkonventionell gedacht hatten, suchten eine Karriere außerhalb der Festanstellung – und zwar in Berlin. Denn es tut sich was in der Hauptstadt: „Es gibt immer mehr Business Angels und Investoren“, sagt Klüwer. Auch Xbird hatte kaum Probleme mit der Kapitalakquise, obwohl Start-ups riskante Anlagen sind. Es gibt mit Ansgard Capital mittlerweile sogar eine eigene Venture-Kapital-Firma, die sich auf Investitionen in KI-Start-ups spezialisiert hat. Deren Gründer Fabian Westerheide bezeichnete Berlin unlängst als den größten deutschen KI-Start-up-Standort und den viertgrößten weltweit. Es bleibt also noch Raum nach oben.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false