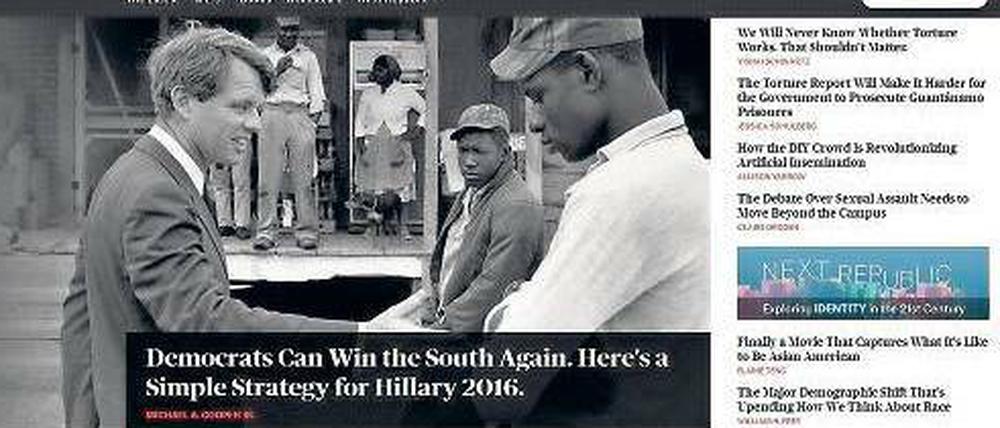
© Tsp
The New Republic: Widgets statt Woolf
Online kills print: Das ruhmbeladene Magazin „The New Republic“ steht vor dem Aus. Zwischen Chefredakteur Chris Hughes und seiner Redaktion ist eine große Kluft.
Es sollte ein großer Abend werden im altehrwürdigen Mellon Auditorium. Einen Steinwurf entfernt vom Weißen Haus traf sich Washingtons Elite in einem neoklassizistischen Prunksaal, um einen 100. Geburtstag zu feiern. Der Jubilar: „The New Republic“, einst als linksliberales Magazin gegründet und längst gefeiert als das Magazin der amerikanischen Intellektuellen. Doch zumindest den Redakteuren wollte der Schampus nicht schmecken. Sie saßen am Katzentisch, ganz hinten. Weit entfernt von Chris Hughes, Verleger des Blattes, der die Sitzordnung höchstpersönlich festgelegt hatte. Hughes ganz vorne am Ehrentisch, die Redakteure ganz hinten – das war kein Zufall. Der Chef hatte sich schon lange von seinen Mitarbeitern entfernt.
Man hätte es ahnen können. Was will ein 31-Jähriger an der Spitze eines Magazins, zu dessen Gastautoren John Maynard Keynes, George Orwell und Virginia Woolf gehörten. Und Thomas Mann. Wer setzt sich an die Spitze eines solchen Kreises? Wie kommt man da hin in jungen Jahren? Ganz einfach: mit Geld. Chris Hughes hat viel Geld, im College war er Zimmergenosse von Marc Zuckerberg, in der ersten Stunde so etwas wie der Marketingchef von Facebook. Statt Geld bekam er Anteile, die ein paar Jahre später 700 Millionen Dollar wert waren. Seither spielt Hughes in der ersten Liga mit und bemüht sich, aus dem Schatten seiner Facebook-Vergangenheit hervorzutreten.
Macht Widgets!
Das ging bisher schief. Eine sozial verantwortliche Online-Plattform namens „Jumo“ stellte Hughes nach einem Jahr mangels Erfolgs ein, mit „The New Republic“ scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Allein: Sie ist ungleich tragischer, hier stirbt ein Stück Medien-Geschichte. Die Redakteure sind entsetzt. Sie seien „intellektuelle Partner für die Ewigkeit“, faselte Hughes diesen Sommer über seinen Chefredakteur Franklin Foer. Sein Engagement für das Blatt unterstrich der neue Verleger mit Millioneninvestitionen: ein neues Büro in New York, neue Räumlichkeiten in Washington. Dann die Kehrtwende: Statt, wie versprochen, langfristig in tiefgründigen Hintergrund- und Meinungsjournalismus zu investieren, wollte der Online-Mann die schnelle Kohle. Bessere Webpräsenz, mehr Klickzahlen. Redakteure forderte er auf, mit Programmierern clevere „Widgets“ zu entwerfen. Foer setzte er einen neuen Chef vor die Nase: Guy Vidra, ehemals Nachrichtenchef beim Online-Service Yahoo.
Bald darauf hörte Foer, dass hinter den Kulissen ein „neuer Chefredakteur“ Kontakte knüpfte – über seine Entlassung hatte man ihn nicht informiert. Foer ging, mit ihm Wiesentier und 50 Redakteure. Die Produktion wurde auf Eis gelegt, vor Februar wird keine neue Ausgabe des einstigen Wochenblattes erscheinen. Wahrscheinlich wird auch danach kein Heft mehr gedruckt. Der geschätzte Hintergrundjournalismus passt nicht zu der Sucht nach Klicks im Internet. Dabei können sich Print und Online vertragen, das zeigt die Übernahme der traditionsreichen „Washington Post“ durch Amazon-Chef Jeff Bezos. Der Online-Milliardär gibt der Zeitung genug Geld, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen, aus redaktionellen Entscheidungen hält er sich raus. Ebay-Gründer Pierre Omidyar hat ein eigenes Medienprojekt gestartet: First Look Media.
"Größer als jeder Einzelne von uns"
Etablierte Zeitungen und Magazine sind kein Spielzeug. Sie sind nicht für wilde Experimente in einem stets neuen Medienumfeld geeignet. Sie haben als Nischenprodukt eine bessere Zukunft als im Internetzirkus, wo es um „Eyeballs“ und um Klickzahlen geht. Dabei ist sich Chris Hughes seiner Sache sicher, er sieht „The New Republic“ nicht am Ende. Das Magazin sei „größer als jeder Einzelne von uns“, kommentierte er den Massenexodus in der Redaktion. Das Blatt werde zurückkommen, besser denn je. Mit dieser Meinung steht er alleine da: „,The New Republic’ ist tot“, titelte Dana Milbank in der „Washington Post“. Er hatte selbst für das Blatt geschrieben und hält Hughes für einen Dilettanten.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false