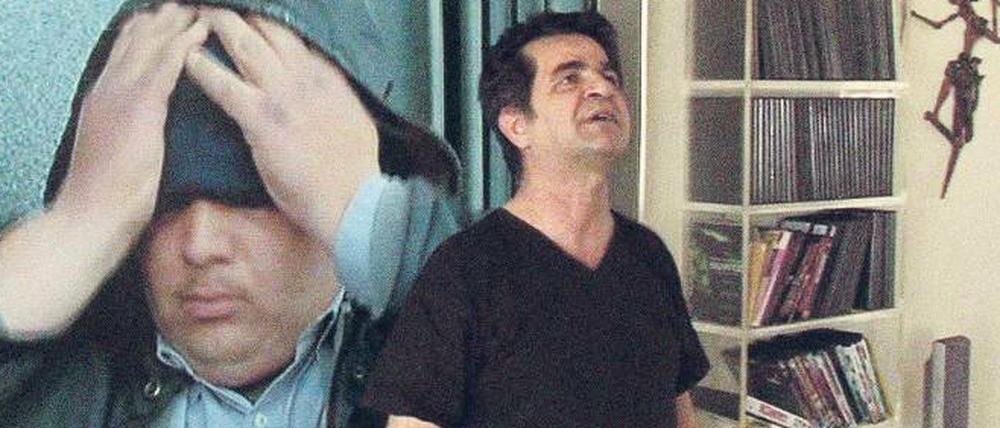
© Palisades Tartan
Regisseure im Iran: Die Kunst, stur zu bleiben
Im Wettbewerb läuft Jafar Panahis „Pardé“. Dabei hat der Regisseur Berufsverbot, sitzt im Iran fest. Dennoch kann er weiterhin Filme drehen - weil die internationale Aufmerksamkeit wie ein Schutzschild wirkt.
Der Coup der 63. Berlinale heißt „Pardé“: Das Werk des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, heute im Wettbewerb, wird mit besonderer Spannung erwartet. Das hat vor allem mit den Umständen seines Entstehens zu tun. Panahi, der 2006 für sein Drama über weibliche Fußballfans im Iran, „Offside“, einen Silbernen Bären gewann, darf keine Filme drehen. 2010 wurde er zu sechs Jahren Haft und 20 Jahren Berufs- und Reiseverbot verurteilt. Man machte ihm ein angebliches Filmprojekt über die Proteste nach der Präsidentschaftswahl 2009 zum Vorwurf.
Die Revision wurde abgelehnt, das Berufsverbot trat umgehend in Kraft. Aber die Haft hat Panahi bis heute nicht antreten müssen. So entstand 2011 „This is not a Film“, das bewegende Dokument eines leidenschaftlichen Regisseurs, der sich seines Lebensinhalts beraubt sieht. Im Hausarrest gedreht, wurde der Film auf einem USB-Stick in einem Kuchen nach Cannes geschmuggelt. Auf der Berlinale 2012 wurde dann ein bewegender Offener Brief Panahis verlesen. „Ich stelle mich der Wirklichkeit der Gefangenschaft und der Häscher. Ich werde nach den Manifestationen meiner Träume in Euren Filmen Ausschau halten: In der Hoffnung, dort das zu finden, was mir genommen wurde“, hieß es darin.
Nun hat er doch wieder einen Film gedreht. In „Pardé (Geschlossener Vorhang)“ verstecken sich ein Mann (Koregisseur Kambuzyia Partovi), der einen unreinen Hund besitzt, und eine Frau, die an einer verbotenen Party teilnahm, in einer abgelegenen Villa. Die Berlinale hat „Pardé“ eingeladen, die Behörden schweigen, Panahi darf nicht kommen, nur die beiden Hauptdarsteller reisen an.
Hat Panahi zu Hause Konsequenzen zu befürchten? Nein, glaubt Morteza Farshbaf, einer der jungen, aufstrebenden Regisseure im Iran, der schon mit Panahi zusammengearbeitet hat und mit der Familie befreundet ist. „Filme zu drehen ist für Jafar Panahi eine Lebensnotwendigkeit“, sagt Farshbaf. „Und der Iran ist für ihn der einzige Ort dafür.“ Farshbaf kann nachvollziehen, dass ein Leben im Exil für den Regisseur nicht infrage kommt. „Die Kultur ist für einen Regisseur wie die Sprache für einen Dichter. Es ist sehr schwer, in einer anderen Kultur zu arbeiten.“ Er erinnert sich an sein Studium bei Altmeister Abbas Kiarostami. „Bleibt euren Wurzeln treu“, gab der den Studenten mit auf den Weg: „Macht iranische Filme.“ Doch Kiarostamis jüngste Filme, „Copie Conforme“ und „Like Someone in Love“ spielen in der Toskana und in Tokio. Asghar Farhadi, Bären- und Oscar-Gewinner für sein Trennungsdrama „Nader und Simin“, hat gerade sein Folgeprojekt „The Past“ in Paris abgedreht. Auch Morteza Farshbaf versuchte bereits, im Ausland zu arbeiten, in Luxemburg. Er fühlte sich jedoch wie ein Tourist: „Es gelang mir einfach nicht, die Seele, die Atmosphäre einzufangen.“
Als er letztes Jahr mit seinem Langfilmdebüt „Soog“ von einer Festivaltour zurückkehrte, wurde Farshbaf von den Behörden einbestellt. „Zwei Monate lang musste ich mich rechtfertigen, weil mein Film internationale Preise gewonnen hatte“, erzählt er. „Es ist eine völlig unpolitische Geschichte. Aber die Zensoren denken, wenn ein Film im Ausland etwas gewinnt, dann müssen sie wohl etwas übersehen haben.“ Wer international reüssiert, hat es schwerer, im Iran einen Film genehmigt zu bekommen.
Auch der im Kölner Exil lebende Autor und Regisseur Ali Samadi („The Green Wave“), der als Vorstandsvorsitzender von „Transparency for Iran“ die Lage der Filmemacher aufmerksam verfolgt, ist überzeugt, dass sich die Situation seit den Wahlen 2009 dramatisch verschlechtert hat. „Die Daumenschrauben wurden angezogen, die Angst geht um, zu Recht. Schon um wirtschaftlich zu überleben, müssen viele sich arrangieren.“ Auch die Kooperation mit ausländischen Sendern, mit Arte oder der BBC, werde schärfer geahndet als früher. „Das hat“, so Samadi, „auch finanzielle Folgen, denn viele Projekte sind früher in Koproduktion mit solchen Sendern entstanden.“
{„Panahi ist sehr stur, im positiven Sinn“}
All das trifft vor allem die arrivierten Regisseure. Auf dem gerade zu Ende gegangenen Fajr Festival, der jährlichen iranischen Werkschau in Teheran, handelte es sich bei fast der Hälfte der Beiträge um Debütfilme. Die Mitarbeiter der iranischen Verleihfirmen auf dem Filmmarkt der Berlinale wollen von einer Krise jedoch nichts wissen und deuten dies als Zeichen für eine lebendige Filmszene. Wenn sich die Lage verschlechtert habe, dann wegen der vom Westen verhängten Sanktionen. Über sie klagt auch Morteza Farshbaf. Um 300 Prozent hätten sich die Waren verteuert, rechnet er vor. Ohne die Unterstützung des Systems sind größere Projekte kaum noch möglich – und die Behörden prüfen genau. Dem Regime, da ist sich Fashbaf sicher, wäre es am liebsten, wenn unbequeme Filmemacher das Land verlassen. Nachdem etwa Bahman Ghobadi „No One Knows About Persian Cats“ drehte, einen kritischen Film über Undergroundmusiker in Teheran, sei ihm die Ausreise nahegelegt worden. Er lebt heute im Irak. Auch Panahi habe man mehrfach Gelegenheit gegeben, das Land zu verlassen. Er tat es nicht – und wurde verurteilt.
Farshbaf meint, dass auch Kiarostami, Farhadi oder Ghobadi es vorziehen würden, im Iran zu drehen. „Der einzige bekannte Regisseur, der momentan noch im Iran dreht, ist Jafar Panahi“, lacht Farshbaf. „Und der hat Berufsverbot.“ Auch weniger prominente Filmschaffende bekommen die Willkür zu spüren, unter der Panahi seit seiner mehrwöchigen Haft im Frühjahr 2010 zu leiden hat. Ende Januar wurde Ghobadis Bruder Behrouz, der als Produzent arbeitet, aus dem Gefängnis entlassen. Und Mojtaba Mirtahmasb, Panahis Koregisseur bei „This is not a Film“, saß mit fünf anderen Filmschaffenden im Herbst 2011 drei Monate in Haft, angeblich wegen Kooperation mit der BBC. Mirtahmasb wartet bis heute auf seinen Prozess, auch er hat Berufs- und Reiseverbot.
Wie kann Panahi trotz Verbot Filme drehen? „Panahi ist sehr stur, im positiven Sinn“, sagt Farshbaf. „Deshalb hat sich für ihn nicht so viel verändert. Er beantragte schon früher keine Genehmigungen, jetzt tut er es erst recht nicht. Er kann es sich erlauben, weil er so bekannt ist. Alle großen Festivals halten einen Stuhl für ihn frei, alle Zeitungen berichten über ihn.“ Es sind also vor allem die weniger Berühmten, die für kleinere Dinge enorme Schwierigkeiten bekommen können. Panahis Risiko ist hoch, aber leichter kalkulierbar. Solange er Filme dreht und nicht aus der internationalen Öffentlichkeit verschwindet, ist er für die Behörden nur schwer antastbar.
Gibt es Anlass zur Hoffnung, dass sich die Lage für Film- und Kulturschaffende wie für Oppositionelle nach den nächsten Wahlen im Juni verbessert? Ali Samadi verneint das. Ist die grüne Bewegung also zerschlagen? „Die Unzufriedenheit hat sich seit 2009 nicht gelegt“, gibt er zu bedenken. „Arbeitslosigkeit, Inflation, die Situation der Frauen, die Zukunftsperspektive für die Jugend - nichts hat sich verbessert, im Gegenteil.“ Samadi startet ein Rechenexempel: Ein Milizionär, der 2009 für das Regime auf Demonstranten einprügelte, verdiente 300 000 Toman, etwa 300 Euro. Heute sind das weniger als 60 Euro. Vermutlich werde der Milizionär sich fragen: Hat es sich gelohnt, was ich damals gemacht habe?
12.2., 16 Uhr (Berlinale-Palast), 13.2., 9.30 Uhr (Friedrichstadt-Palast), 10 Uhr (HdBF), 17.2., 18 Uhr (Cubix 8)
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false