
© vario images
Kunststoffverpackungen für Lebensmittel und die Alternativen: Alles Plastik - oder was?
Gurken in Plastikfolie, eingeschweißter Käse, Fast Food in Alu – was für ein Müll! Selbst Bioläden kommen nicht ohne aus. Doch erste Innovationen zeigen: Es geht anders.
Biosupermärkte boomen, längst nicht mehr nur in Prenzlauer Berg. Doch wer sie betritt, wundert sich. Ob Seitanschnitzel oder Tofuwürstchen – was es hier zu kaufen gibt, erhebt meist den Anspruch, fleischlos, gesund und fair produziert zu sein. Doch der Verpackungsmüll, der zurückbleibt, wirft andere Fragen auf: Wie nachhaltig können eingeschweißte Biogurken oder Dinkelbratlinge im Plastikmantel sein? Und wie gesundheitsschädlich ist die Verpackung selbst?
Antje Müller von „denn’s Biomarkt“ macht strenge EU-Vorgaben zu Hygiene und Sicherheit verantwortlich. Bei alternativen Verpackungen wie Pappkartons bestehe die Gefahr, dass Mineralölrückstände aus dem recycelten Material ins Lebensmittel eindringen. So sei oft noch eine zusätzliche Plastikverpackung nötig.
Wo landet der ganze Müll?
Kunststoffe sollen unsere Lebensmittel schützen, zum Beispiel vor Verunreinigungen. Sie sollen den Transport unseres Essens erleichtern, vom anderen Ende der Welt oder vom Burgerladen um die Ecke – denn Plastik wiegt ein Vielfaches weniger als etwa Glas oder Holz. Und schließlich sollen sie dafür sorgen, dass die einzeln verpackte Scheibe Käse im Kühlschrank eines Singlehaushaltes tagelang Aroma und Geschmack bewahrt. Doch wo landet der ganze Müll?
In den Weltmeeren schwimmen laut Umweltbundesamt mehr als 140 Millionen Tonnen Abfall, rund drei Viertel davon sollen Kunststoff sein. Jahr für Jahr kommen Schätzungen zufolge bis zu zehn Millionen Tonnen hinzu. Im Nordpazifik treibt inzwischen ein Müllteppich der Größe von Deutschland und Frankreich. Allein hierzulande würden jährlich knapp drei Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen entsorgt, berichtet das Fraunhofer-Institut, nicht einmal die Hälfte davon werde wiederverwertet.
Fische werden zu Zwittern
Der Wiener Filmemacher Werner Boote wurde unruhig, als er 1999 in einer englischen Zeitung auf einen kurzen Artikel stieß. Bestimmte Fischarten, hieß es darin, könnten sich wegen des Plastikmülls in den Ozeanen nicht mehr fortpflanzen. Die von den Tieren für Plankton gehaltenen und deshalb gefressenen Kunststoffpartikel im Meer, das sogenannte Mikroplastik, würde den Hormonhaushalt der Fische derart durcheinanderbringen, dass Zwitterwesen entstünden – männliche Tiere bildeten Eizellen und wurden auf diese Weise unfruchtbar. „Das kann doch nicht wahr sein“, habe er damals gedacht, erzählt Boote im Telefoninterview, „sonst wäre das schließlich der absolute Wahnsinn.“
Also begann er zu recherchieren. Zehn Jahre sollte es dauern, bis sein Kinofilm „Plastic Planet“ 2009 Premiere feierte. Die Geschichte mit den Fischen stimmte, vieles andere auch. In seinem eigenen Blutplasma ließ Boote deutlich erhöhte Werte an schädlichen Substanzen nachweisen, die aus dem Kontakt mit Kunststoffen stammten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten starb jedes dritte Kamel an herumfliegenden Plastiktüten, fand Boote heraus und informierte den herrschenden Scheich. Der verbot zehn Tage später den Verkauf von Tüten.
Je billiger der Kunststoff, desto gefährlicher

© promo
So schnell und unbürokratisch geht es in Europa nicht zu. „Es dauert ewig, bis ein Zusatzstoff verboten wird“, sagt er. Immerhin führte sein Film dazu, dass 2011 die Verwendung von Bisphenol A (BPA) in Babyflaschen und Schnullern EU-weit verboten wurde. Der Weichmacher gilt wegen seiner Wirkung auf den Hormonhaushalt als gesundheitsschädlich.
Solange Weichmacher, „Phthalate“, im Kunststoff gebunden sind, besteht keine Gefahr. Doch wird das Material erwärmt oder die Oberfläche durch Reibung zerstört, wird es mit der Zeit porös, dann treten Giftstoffe aus. So sind sie auch im Hausstaub zu finden. Je billiger ein Kunststoff produziert ist, desto schneller lösen sich die Partikel, desto schneller entwickelt das Plastik seinen charakteristischen Geruch. Weil Kunststoffe von sich aus eine spröde Struktur besitzen, werden ihnen die Weichmacher beigefügt.
Manche von ihnen können erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen: Unfruchtbarkeit, Diabetes, Leberschäden bei Kindern im Mutterleib.
Als Mustafa Demirtas begann, Plastik aus seiner Küche zu verbannen, musste der Berliner sich „Ökopapa“ schimpfen lassen. Der seltsame Eigengeschmack, den PET-Flaschen entwickeln, wenn sie lange in der Sonne liegen, hatte Demirtas schon lange skeptisch gemacht. In seinem Beruf als Medizintechniker hörte er von dem Zusammenhang zwischen Weichmachern und Fettleibigkeit. Bootes Film „Plastic Planet“ beunruhigte ihn. Auch der unangenehme Geruch von Kunststoffdosen bereitete ihm zunehmend Sorgen, wenn er die Schulbrote für seine beiden Kinder hineinlegte.
Also wagte Demirtas den Schritt und sortierte alle Kunststoffdosen aus. Gar nicht so einfach, wie er merkte. „Plastik ist eben auch ziemlich praktisch.“ Die Brotdosen ersetzte er durch solche aus Edelstahl. Nun, ein paar Jahre später, sorgt die Idee von damals für seinen Lebensunterhalt.
Edelstahlbox statt Tupperdose
„ECO Brotbox“ nennt sich Demirtas’ Geschäftsidee. Edelstahlbehälter, wie der 46-Jährige sie zunächst seinen Kindern mitgab, verkauft er jetzt über Filialen der Supermarktkette Bio Company oder bei „Original Unverpackt“. Die Eröffnung des Kreuzberger Ladens, der ganz ohne Einwegverpackungen auskommt, ging im vergangenen Jahr durch die Medien. Seitdem hat die Idee der beiden Gründerinnen reichlich Nachahmer gefunden, ähnliche Geschäfte gibt es in Bonn, Mainz oder Dresden. Müsli und Nudeln, aber auch Öl oder Waschmittel: Vieles lässt sich dort in mitgebrachte Behälter abfüllen. Wer sie zu Hause vergessen hat, kann vor Ort gegen eine Gebühr Gläser ausleihen. Doch noch gibt es Grenzen. Tomatenmark etwa oder Sojamilch fanden die beiden Gründerinnen von „Original Unverpackt“ partout nicht verpackungsfrei.
Mustafa Demirtas bleibt derweil seinem Edelstahl treu. Nach den Brotboxen sammelte er vor Kurzem per Crowdfunding 30 000 Euro für sein „Tiffin-Projekt“, Anfang September soll es starten. Demirtas und drei Mitstreiter möchten gegen den Müll angehen, der durch Take-away-Essen anfällt, 119 Tonnen seien das weltweit täglich. In den zehn bislang am Projekt teilnehmenden Berliner Lokalen wird man künftig auf Wunsch stapelbare Edelstahlbehälter statt der üblichen Kunststoffschalen erhalten, leihweise und kostenlos. Innerhalb einer Woche muss man sie dann zurückbringen, eine App soll rechtzeitig daran erinnern.
Auch zu herkömmlichen Frischhaltefolien gibt es bereits Alternativen: „Bee’s Wrap“ nennt sich eines dieser Produkte, „Bienenhülle“. Das mit Wachs, Öl und Harz behandelte Baumwollgewebe lässt sich nach Aussage des Herstellers wiederverwenden, es eigne sich für Obst und Gemüse, Käse und Brot, nicht allerdings für rohes Fleisch. An anderen Materialien wird noch geforscht, beispielsweise am „Biokunststoff“.
Kompostierbare Verpackungen aus Mais
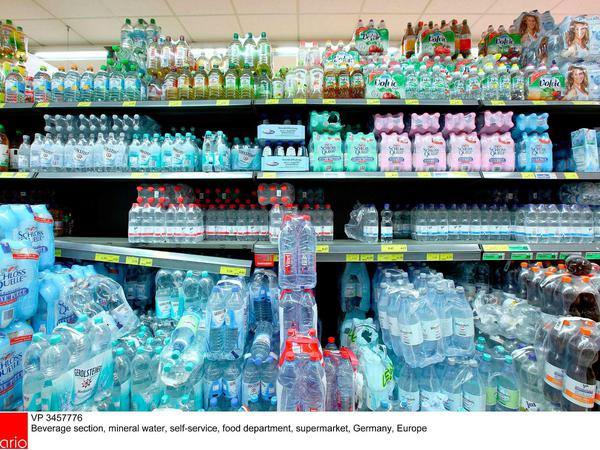
© vario images
Die Anforderungen an solch einen neuen Stoff sind komplex, entscheidend sind die sogenannten Barriereeigenschaften: Gerüche und Dämpfe sollen weder aus der Folie entweichen noch das verpackte Lebensmittel selbst erreichen. Am Würzburger Fraunhofer-Institut für Silicatforschung entwickelt man derzeit eine „hybride Kunststoffbeschichtung auf Basis von Biopolymeren“. Dahinter verbirgt sich ein kompostierbares, antibakteriell wirksames Beschichtungsmaterial für Verpackungen und Folien, eine Art Lack.
Im Januar wurde es auf der Grünen Woche vorgestellt, bis zum kommenden März wird das Material weiter geprüft. Bei dessen Abbau, der rund sechs Wochen dauert statt etliche hundert Jahre wie bei herkömmlichen Kunststoffen, bleibt lediglich Siliciumdioxid zurück – besser bekannt als Sand.
Andere kompostierbare Verpackungen existieren bereits, doch stamme die aus Mais gewonnene Stärke darin häufig aus gentechnisch manipulierten Pflanzen, wie Antje Müller von „denn’s“ beklagt. „In Kompostierwerken müssen diese Folien aus Biokunststoffen aussortiert werden, da sie langsamer verrotten als andere organische Stoffe.“ Ein weiteres Problem: dass das Material trotz entsprechender Kennzeichnung oft im gelben Sack entsorgt werde und so das Recycling herkömmlicher Kunststoffe behindere.
„Plasticarians“ nennen sich die Abstinenzler
Karla Pfaff kennt sich aus mit Verpackungen. Seit 25 Jahren arbeitet sie für das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), leitet dort den Bereich „Sicherheit von Produkten mit Lebensmittelkontakt“. Ihr Institut weist darauf hin, welche Stoffe in welcher Weise verwendet werden sollten, und empfiehlt Herstellern klare Verwendungshinweise. Eine dieser Empfehlungen lautet, Aluminiumfolie nicht mit säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln zu verwenden, weil sich sonst Ionen des Metalls aus dem Material lösen und ins Essen übergehen könnten. Andere Materialien dürfen nicht mit fetthaltigen Lebensmitteln in Berührung kommen.
Für das Leben ohne Kunststoff gibt es inzwischen einen Begriff: „Plasticarians“ nennen sich die Abstinenzler. Auch wenn Boote selbst keiner geworden ist, merkt man ihm den Stolz über das Erreichte an. Seit seinem Film, so sagt er, seien Studien zu den Risiken von Plastik leichter finanzierbar. Inzwischen gibt es Pläne für einen zweiten Teil von „Plastic Planet“. An Material dürfte es nicht mangeln.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false