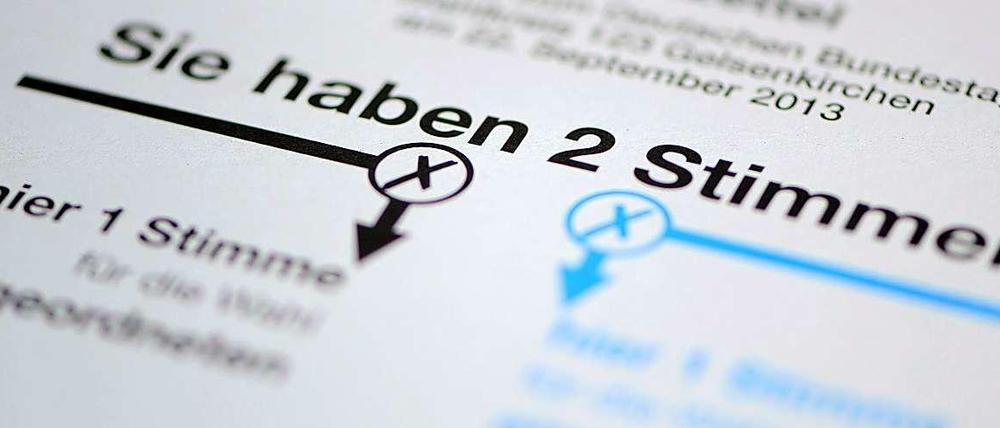
© dpa
Wählen und die Gesundheit: Teamarbeit im Gehirn
Die Bundestagswahl ist vorbei. Aber was passiert eigentlich im Kopf, wenn wir Entscheidungen fällen? Und wie beeinflusst dieser Vorgang unser Wohlbefinden? Eine kleine psychologische Einführung.
Die gute Nachricht für alle, die am Sonntag ins Wahlbüro gepilgert sind, egal welchem Kandidaten und welcher Partei sie ihre Stimme gegeben haben: Sie werden es nicht bereuen. Fehlentscheidungen hat es dabei nämlich nicht gegeben.
Das behauptet jedenfalls Daniel Gilbert, Professor für Psychologie an der Harvard-Universität. Und erklärt es mit dem „psychischen Immunsystem“ des Menschen, das es ihm ermögliche, selbst objektiv recht verheerende Folgen eigener Entscheidungen – etwa den Kauf eines Hauses an einer verkehrsreichen Straße – im Nachhinein vor sich selbst in Erfolge umzudeuten. „Wir sind sehr gut darin, die Welt in ein neues Licht zu stellen“, so Gilbert in seinem Buch „Ins Glück stolpern“. Als Meister des Selbstbetrugs werden wir, wenn das stimmt, die von uns am Sonntag Gewählten in den nächsten vier Jahren in schmeichelhafterem Licht sehen als ihre politischen Gegner, denen wir die Stimme verweigert haben. Auch dass Nichtwähler die deutsche Politik weiterhin als ärgerlichen Einheitsbrei erleben werden, lässt sich auf diese Weise gut erklären.
Wie aber sind wir überhaupt zu unserer Entscheidung für oder gegen das Wählen, für oder gegen die zur Wahl Stehenden gekommen? Und was ist dabei in unserem Kopf passiert? In den letzten Jahren hat die Hirnforschung eindrücklich herausgearbeitet: Ein kühler Kopf allein genügt nicht, um Entscheidungen zu fällen. Eindrücklich zeigt das der Fall des Patienten Elliot, den der amerikanische Neurologe Antonio Damasio in seinem Buch „Descartes’ Irrtum“ vorstellt: Ein intelligenter Mann, der, nachdem ihm ein gutartiger Hirntumor entfernt worden war, nicht mehr in der Lage war, seinen Tagesablauf zu planen oder auch nur eine einzige alte Zeitung wegzuwerfen. Er hatte bei dem Eingriff auch bestimmte Regionen beider Stirnlappen eingebüßt – und damit Gefühle, ohne die keiner fähig ist, sich zu etwas durchzuringen, so intelligent er oder sie auch sein mag. Als Damasio ihn traf, stand Elliot seinem eigenen Leben in fassungsloser Distanziertheit gegenüber. Rationale Abwägungen konnte er zwar treffen – aber keine Entscheidungen.
Letztlich haben Entscheidungen immer eine emotionale Basis
„Entscheidungen sind immer emotional, wie lange man auch abgewogen hat, und rationale Argumente wirken auf die Entscheidung nur über die mit ihnen verbundenen Emotionen, das heißt Erwartungen und Befürchtungen ein“, schreibt der Neurobiologe Gerhard Roth in seinem Buch „Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten“. Und mehr noch: „Wir sind mit unseren Entscheidungen nur dann zufrieden, wenn sie ihren Grund in den tiefer liegenden limbischen Ebenen unserer Persönlichkeit haben.“
Diese Region ist unter anderem für emotionale Bewertungen zuständig. Wie bedeutsam sie sind, zeigt die Geschichte von dem jungen Mann, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden konnte. Er soll den großen Benjamin Franklin um Rat gefragt haben, der ihm nahe legte, eine Liste mit Pro- und Contra-Argumenten für beide Partnerinnen anzulegen. Der Mann tat es – und heiratete schließlich die, für die weniger sprach. Das beweist allerdings nicht, dass die Liste nicht nützlich gewesen wäre. „Eine solche Sammlung von Argumenten kann durchaus helfen, zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen“, gibt Charité-Psychiaterin Isabella Heuser zu bedenken.
Mehrere Bereiche des Hirns greifen bei einer Wahlenentscheidung ineinander

© dpa
Vielleicht nicht erst in der Wahlkabine, aber in den Wochen davor leisten bei nachdenklichen Wählern mehrere Zentren des Gehirns beeindruckende Teamarbeit, die Roth in seinem Buch detailliert schildert: In der Großhirnrinde ist der obere, dorsolaterale Teil des vorderen Stirnlappens aktiv, wenn Argumente und Programme rational erfasst werden sollen. Im benachbarten ventromedialen vorderen Stirnlappen werden die längerfristigen Folgen von Handlungen geprüft. Im entwicklungsgeschichtlich älteren limbischen System des Hirns bewertet die Amygdala, auch „Mandelkern“ genannt, emotionale Signale, im Hippocampus (dem „Seepferdchen“) werden diese Bewertungen abgespeichert.
In alle diese Prozesse fließen Persönlichkeitsstruktur und Vorerfahrungen des Einzelnen ein, die bewusste und unbewusste Einstellungen prägen. In einer Online-Untersuchung rund um die letzte Bundestagswahl hat der Psychologe Malte Friese von der Universität des Saarlandes belegen können, dass beides verzahnt ist, dass letztlich aber, auch bei kurz vor der Wahl noch Unentschlossenen, doch die expliziten, bewussten Einstellungen bedeutsamer sind. „Wahlentscheidungen sind eine komplexe Angelegenheit“, resümiert Jürgen Margraf, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
Das Wissen über das System der parlamentarischen Demokratie, über Parteiprogramme und Ziele der Kandidaten sei bei den meisten Bürger von Demokratien dagegen eher bescheiden, stellt sein Kollege Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin fest. Dass George W. Bush keinen Broccoli mag, hätten praktisch alle Amerikaner gewusst. Dass er die Todesstrafe befürwortete, sei sehr viel weniger US-Bürgern klar gewesen.
Mit jeder Entscheidung für etwas entscheidet man sich zugleich gegen etwas
Gigerenzer befasst sich seit Jahren intensiv mit der Frage, wie Menschen im Alltag trotz schlechten Wissensstandes zu halbwegs vernünftigen Entscheidungen gelangen können. Hat man keinerlei andere Informationen, könne es zum Beispiel vernünftig sein, bei einer Kaufentscheidung die Bekanntheit des Produkts zum Kriterium zu machen, schreibt er in seinem Buch „Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition“. Heuristiken auf schmaler Informationsbasis, die mit ein bis zwei einfachen Regeln auskommen, sind nach seiner Überzeugung oft genauso effizient wie komplexe Rechenoperationen.
Klassisch, wenn auch heute nicht mehr uneingeschränkt brauchbar, ist die Anordnung der zur Wahl stehenden Parteien von links nach rechts. Gigerenzer nennt sie die „Perlenheuristik“: Die Wähler nehmen dabei Parteien wie Perlen auf einer Kette wahr, von rechts nach links. Irgendwo auf dieser Kette ist ihr eigener politischer Standort. „Je näher eine Partei meinem Idealpunkt auf dem Links- Rechts-Kontinuum kommt, desto größer ist meine Präferenz.“ Einer seiner Studien zufolge wenden 92 Prozent der Wähler diese einfache Faustregel an. Stammwähler oder „soziale Wähler“, die sich in ihrer Entscheidung nach ihrem Umfeld richten, haben eine noch simplere Richtschnur.
„Es gibt allerdings auch Menschen, die sich aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur mit Entscheidungen prinzipiell schwer tun“, meint Isabella Heuser. „Man muss es aushalten, dass man sich im Leben mit jeder Entscheidung zugleich gegen etwas anderes entscheidet.“ Wem das prinzipiell schwer fällt, der war gestern wohl nach dem Verlassen des Wahllokals umso erleichterter. Körpereigene Botenstoffe haben zusätzlich für Belohnung gesorgt. „Das Dopaminsystem ist in dieser Situation aktiviert, wir haben etwas geleistet“, resümiert Heuser die Situation.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false