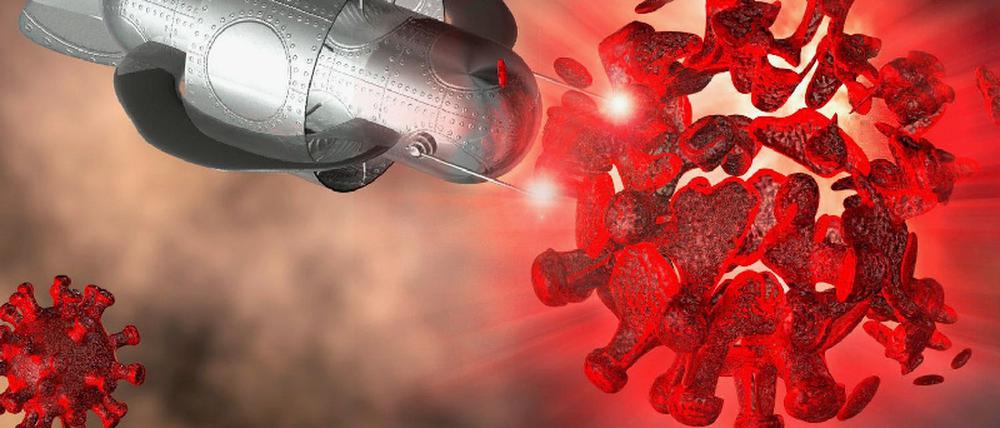
© Illustration/p-a
Nanotechnik: Im Reich der Zwerge
Dank Nanotechnik entstehen neue Materialien, die möglicherweise auch dem Kampf gegen Krebs nützen.
Es war ein kurioser Auftrag. Die US- Raumfahrtbehörde Nasa fragte den Wissenschaftler Bradley C. Edwards, ob es möglich sei, einen Weltraumfahrstuhl zu bauen. Der Lift, so die Idee, solle an einem Kabel emporfahren, das am Boden befestigt ist und bis in eine erdnahe Umlaufbahn reicht – eine Strecke von 36 000 Kilometern. Nach umfangreichen Berechnungen kam Edwards zu einem Ergebnis: Der Fahrstuhl ist machbar, sofern das Aufzugskabel aus bestimmten synthetischen Molekülen besteht, die Forscher als Kohlenstoff-Nanoröhren bezeichnen. Dann könne es sein enormes Eigengewicht von einigen hunderttausend Tonnen aushalten und zusätzlich noch die Aufzugskabine tragen.
Visionen dieser Art tragen dazu bei, dass Nanotechnologie als etwas Futuristisches wahrgenommen wird, das scheinbar ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. „Unter dem Begriff sind aber einige Dinge vereint, die es schon seit Jahrzehnten gibt und die man früher nur anders genannt hat“, sagt Volkmar Richter vom Fraunhofer-Institut für keramische Technologien in Dresden.
So bezeichnen beispielsweise viele Lackhersteller ihre Erzeugnisse als nanotechnologische Produkte. Der Grund: Die Lacke enthalten Pigmente, die nur wenige milliardstel Millimeter groß sind. Mitunter sind die Waren seit mehr als 40 Jahren auf dem Markt, die wohlklingende Vorsilbe „nano“ haben sie aber erst in neuerer Zeit erhalten – aus Verkaufsgründen. Auch bei den Nanomaterialien in Autoreifen handelt es sich meist nur um Rußpartikel, die schon seit geraumer Zeit als Kunststoff-Beimischung dienen.
„Nanotechnologie ist ein Modewort“, sagt Richter. Die Vorsilbe „nano“ (griechisch für Zwerg) sei heute ähnlich beliebt wie in den achtziger Jahren das Präfix „mikro“ und in den Neunzigern das vorangestellte „e-“. Im Prinzip lasse sich der Begriff Nanotechnologie immer dann anwenden, wenn man Strukturen herstellen oder bearbeiten will, die kleiner sind als 100 Nanometer (ein Nanometer ist ein milliardstel Meter). Das entspricht etwa der Breite eines menschlichen Haares.
Die winzigen Strukturen bieten einige Vorteile, sagt Richter: „Als Werkstoffforscher können wir mithilfe der Nanotechnik sehr harte Materialien herstellen.“ Ein Beispiel sind Bohrer aus Wolframkarbid und Kobalt. „Die Ausgangsstoffe für diese Bohrer werden als Pulver in eine Form gepresst und dann erhitzt, so dass sie miteinander verbacken“, erklärt der Wissenschaftler. Je kleiner die Pulverkörner seien, umso härter werde das entstehende Material. Mit Korngrößen unter 100 Nanometern lasse sich ein Wolframkarbid-Kobalt-Gefüge erzeugen, das doppelt so hart ist wie Stahl. „Damit kann man problemlos durch Metalle oder Beton bohren“, sagt Richter.
Ein weiteres Anwendungsgebiet für Nanotechnik sind moderne Computerchips: Ihre Schaltkreise sind inzwischen nur noch einige milliardstel Meter groß. „In diesen Größenordnungen machen sich bereits quantenmechanische Effekte bemerkbar“, sagt Karl-Heinz Haas vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg und Sprecher des Fraunhofer-Themenverbunds Nanotechnologie. Die Isolatorschichten zwischen den Leiterbahnen seien mittlerweile so dünn, dass sie von den Elektronen durchtunnelt würden, so dass sie ihre isolierende Wirkung verlieren. Zudem hätten die filigranen Leiterstrukturen einen unverhältnismäßig hohen elektrischen Widerstand, weshalb die Computerchips im Betrieb sehr heiß würden.
Im Zusammenhang mit Nanotechnologie werden oft neue Materialien genannt, die aus maßgeschneiderten Molekülen bestehen. Am bekanntesten sind die Kohlenstoff-Nanoröhren (Carbon Nanotubes) – winzig kleine Röhren aus Kohlenstoff. Die Kohlenstoffatome bilden dabei eine Schicht mit einem Bienenwabenmuster, die wiederum zu einer Röhre aufgerollt ist.
Carbon Nanotubes haben fantastische Eigenschaften. Sie leiten elektrischen Strom tausendmal so gut wie Kupfer und Wärme zweimal so gut wie Diamant, der beste natürlich vorkommende Wärmeleiter. Sie sind viel leichter als Stahl, aber zigfach fester als dieser. Das ist der Grund, warum manche Forscher ernsthaft darüber nachdenken, aus ihnen ein Aufzugskabel für einen Weltraumlift herzustellen. „Aus meiner Sicht ist das völlig utopisch“, sagt Haas. Auf anderen Gebieten werden sie allerdings schon heute eingesetzt, beispielsweise in kratzfesten Lacken. Bereits ein sehr geringer Anteil von Nanoröhren im Lack macht diesen äußerst widerstandsfähig.
In Zukunft sollen die Polymermoleküle auch die Medizin voranbringen: So könnte man pharmazeutische Wirkstoffe in Hüllen aus maßgeschneiderten Molekülen verpacken, die ihren Inhalt nur am Krankheitsherd freisetzen, hofft Haas. „Dadurch lassen sich Krankheiten gezielter bekämpfen.“ Weil weniger Wirkstoffe nötig seien, wären auch deren Nebenwirkungen geringer.
Das Berliner Unternehmen Magforce zum Beispiel testet derzeit ein nanotechnisches Verfahren zur Krebstherapie, das an der Charité entwickelt wurde. Es sieht vor, magnetische Nanopartikel in den Körper zu bringen, die sich vor allem in Tumoren ansammeln. Anschließend wird von außen ein magnetisches Feld angelegt, das seine Orientierung ständig ändert und somit die Partikel in heftige Bewegungen versetzt. Dabei erhitzt sich das Tumorgewebe auf bis zu 70 Grad Celsius und stirbt ab. „Das funktioniert aber nur mit Partikeln, die höchstens 15 Nanometer groß sind“, sagt Haas. „Wären sie größer, könnten sie dem äußeren Magnetfeld nicht schnell genug folgen, und der Tumor würde sich nicht genügend erwärmen.“
Die Nanotechnik gilt in Deutschland längst als eine Schlüsseltechnologie. Mit rund 290 Millionen Euro fördert die Bundesrepublik entsprechende Forschungsprojekte. Zum Vergleich: In der gesamten EU sind es 740 Millionen Euro.
Bei der weiteren Entwicklung der Technologie erwartet der Fraunhofer-Forscher Richter große Fortschritte vor allem in der Nanomedizin und -biologie. Dort bestehe großes Interesse an nanotechnologischen Substanzen, mit denen man beispielsweise Membranproteine von biologischen Zellen beeinflussen kann. Mithilfe solcher Substanzen ließen sich Medikamente oder Giftstoffe in Zellen einschleusen.
Allerdings könne man mit Nanotechnologie nicht in beliebig kleine Größenordnungen vordringen, stellt der Wissenschaftler klar. Sobald einzelne Atome manipuliert würden, sei die Grenze erreicht – kleiner ginge es einfach nicht. „Und da sind wir schon fast angekommen“, sagt Richter. „In Zukunft wird es deshalb vor allem darum gehen, Nanotechnik für die Massenproduktion nutzbar zu machen.“
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false