
Der Film "Warschau 44" schildert den Aufstand im August 1944 aus der Perspektive junger Polen. Er ist die Antwort auf den ZDF-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter"

Der Film "Warschau 44" schildert den Aufstand im August 1944 aus der Perspektive junger Polen. Er ist die Antwort auf den ZDF-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter"

Drei Monate nach Deutschlands Kapitulation endete der Weltkrieg im Sommer 1945 mit zwei Atombomben. Japan und Hiroshima ringen mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zwischen Opferrolle und eigener Verantwortung. Eine Spurensuche von unserem Japan-Korrespondenten.
Die fünf Atommächte bestimmen die Geschicke der Welt. Schon deshalb versuchen Staaten immer wieder, an die Bombe zu kommen.

Welthit aus Großbritannien: Carol Reeds Thriller „Der dritte Mann“ ist in einer aufwendigen DVD-Edition neu erschienen. Über Comedy Thriller, Kuckucksuhren und die Wiener Kanalisation.
Vor wenigen Jahren grub ein Dachs einen Slawenschatz aus. Blinkendes Gold oder Silber im Acker sind aber Ausnahmen. Hobbyarchäologen sind trotzdem weiter auf der Suche

Zum zehnten Mal besuchen israelische Schüler mit ihren deutschen Austauschpartnern Potsdam und beschäftigen sich bei einem Besuch in der Nagelkreuzkapelle mit der Geschichte der Garnisonkirche.

Jedes Jahr werden sie wieder getötet. Die fünf Schwarzen, die der Ku Klux Klan 1946 in Georgia lynchte. Der Bürgerrechtler Tyrone Brooks hat aus den Morden ein Theaterstück gemacht – als Mahnung. Den Auftrag hat er von Martin Luther King persönlich.

Jenseits der Rentierromantik: Nördlich des Polarkreises kämpfen die Sami für das Recht auf Selbstbestimmung – und streiten um die Frage, wer dazugehören darf.

Im Fall des vermissten Elias aus Potsdam meldeten sich auch Hellseher mit Hinweisen bei der Polizei – ohne Erfolg. Kein Wunder? Ein Blick in die wundersame Geschichte der Kriminaltelepathie in Deutschland.
Die Nagelkreuzkapelle zeigt wiederentdecktes Inventar aus der Nachkriegskapelle in der Garnisonkirchenruine. Der Verein Mitteschön feiert demnächst die „Spur der Steine“

Wenn der Mensch seinen Kampf gegen das Schnitzel verliert, schlägt die Stunde der Doggy Bags: einst belächelt, nun designt und als nachhaltig gefeiert. Ein Essay.
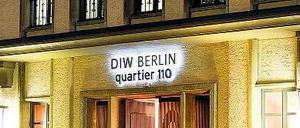
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) arrangierte sich gut mit dem NS-Staat. Auch nach 1945 blieb es noch lange inhaltlich abhängig. Ein Gastbeitrag.
15 Freiwillige aus Deutschland und Polen helfen beim Sommerlager fürs Glindower Gemeindehaus

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) war eng in die Entstehung des „Generalplan Ost“ in der NS-Zeit verstrickt. Eine Ausstellung zur Beteiligung der DFG macht nun Station in der Topographie des Terrors in Berlin.

Die Nachfrage auf Berlins Immobilienmarkt ist groß, Wohnungssuchende haben viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Neben Portalen können persönliche Kontakte zu Anbietern nutzen.

"Angsträume" in Städten beschleunigen unseren Puls und Schritt. Wie Stadtplaner und Architekten gegensteuern können.

An die Helden des 20. Juli erinnert sich fast jeder. Doch Widerstand gegen Hitler gab es nicht nur im Militär, sondern auch in den Gewerkschaften. Ein Gespräch mit dem Historiker Siegfried Mielke.
Er leitete die Geschicke von Nowawes in jenen unruhigen Zeiten, als der Erste Weltkrieg tobte und die Novemberrevolution die Monarchie hinwegfegte: Der Kommunalpolitiker Paul Neumann, an den heute eine Straße in Babelsberg erinnert, war von 1917 bis 1921 Gemeindevorsteher von Nowawes – einem damals selbstständigen Ort auf dem Gebiet des heutigen Potsdamer Stadtteils Babelsberg. Aus Anlass seines 150.

Leinenzwang, Maulkorbverordnung - alles schon mal da gewesen. Der Hund war bereits im 18. und 19. Jahrhundert das umstrittenste Wesen Berlins, aber viele Berliner hatten auch schon damals ein Herz für jede Schnauze. . Stadtgeschichte(n) mit Schmusekugeln, Streunern, Karrenkötern, Clownshunden und vierbeinigen Grenzgängern. Ein Streifzug durch mehr als 250 Jahre Hundeleben in Berlin.

Eine wahre Entdeckung: „Halka“ von Stanisław Moniuszkos ist das Symbol der polnischen Nationaloper. In Posen wird der Klassiker um eine verzweifelte Liebesgeschichte von 1858 in die Gegenwart geholt.

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg erlaubt Japan Kampfeinsätze der Armee im Ausland - gegen den Willen der Bürger.

Der Gouverneur von Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, wünscht sich zur Eröffnung der örtlichen Arena für die WM 2018 die deutsche Nationalmannschaft als ersten Gegner.
Am 17. Juli 1945 begann das Treffen der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges in Potsdam. Der Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker erklärt im PNN-Interview, warum Deutschland nach der Potsdamer Konferenz gar nicht aufgeteilt werden sollte.

Das Urteil im Lüneburger Auschwitz-Prozess gegen Oskar Gröning ist gefallen: vier Jahre Haft für den früheren SS-Buchhalter. Lesen Sie hier das Plädoyer von drei Nebenanklagevertetern.

Karotten erhöhen das Sehvermögen: Dieses Gerücht erfanden die Engländer im Zweiten Weltkrieg zu Propagandazwecken. Mit Gerüchten soll die Öffentlichkeit immer wieder bewusst getäuscht werden. Die britische Historikerin Jo Fox erforscht, wann Manipulationen erfolgreich sind.

Wilhelmshorster renoviert 100-jährige Station. Dort soll ein Trampolin-Verein entstehen.

Angela Merkel ist zuversichtlich, Sigmar Gabriel ist es auch: Die meisten rechnen mit einer Zustimmung des Bundestages zu einem neuen Griechenland-Hilfspaket. Lesen Sie in der Chronik die Ereignisse des Tages.

Für das ehemalige Kino Gloria Palast am Ku'damm gibt es einen neuen Investor, der die leer stehenden Etagen füllen will. Zum Projekt gehören auch zwei Nachbarhäuser.

"Wer beim Referendum für ein Nein war, kann jetzt nicht Ja sagen", erklären die Linken-Politiker Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch zum Brüsseler Griechenland-Kompromiss.

Osteuropa-Historiker Philipp Ther spricht über den Weg der neuen EU-Staaten zur Marktwirtschaft, die Kosten der Reform und Unterschiede zu Griechenland.

Viermal Weltmeister, dreimal Europameister - die Fußball-Nationalelf ist "die Mannschaft" in Deutschland. Und das nicht erst seit dem WM-Titel 2014.

Eklat bei der Gedenkfeier zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica: Aufgebrachte Demonstranten vertrieben den serbischen Premier Aleksandar Vucic und bewarfen ihn mit Steinen. Vucic reagierte nach dem Vorfall versöhnlich.
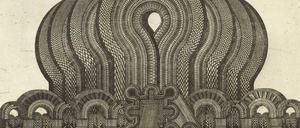
Architekt, Kurator, Museumsdirektor: Johannes Gachnang war eine schillernde Gestalt. Die Berliner Kienzle Art Foundation erinnert nun an seine obsessive künstlerische Seite

Die Frage nach der Schuld: Heute jährt sich das Massaker von Srebrenica zum 21. Mal. Boudewijn Kok war als Blauhelmsoldat dabei, er ließ sich das Datum in die Haut stechen.
Sie gehört zu den ältesten Musikkulturen der Welt, seit 3000 Jahren: die jüdische Gesangstradition. Die Juden, die nach der Verbannung aus Judäa um 70 nach Christus nach Spanien flüchteten, haben sich mit den sephardischen Liedern eine unverwechselbare eigene musikalische Welt geschaffen.

Die Ignoranz der Euro-Lenker nährt einen bösen Verdacht: Es geht ihnen gar nicht um Prosperität, sondern um den Rückbau des Wohlfahrtsstaates. Ein Kommentar.

Wanderung durch die Ödnis: Viggo Mortensen und Reda Kateb spielen in „Den Menschen so fern“ zwei gegensätzliche Männer, die im ausbrechenden algerischen Kolonialkrieg Gemeinsamkeiten entdecken.

Der Dom in Brandenburg an der Havel feiert sein 850. Jubiläum. In der NS-Zeit öffnete die Gemeinde den Nazis die Türen. Schon 1933 ergab sie sich widerstandslos dem Ansturm der Deutschen Christen, aus deren Reihen sich fortan das Führungspersonal rekrutierte.

April 1945, die Rote Armee rückt in Mahlow ein. Erik Reger, Schriftsteller und Journalist, führt ein packendes Tagebuch über das Kriegsende vor seiner Haustür. 60 Jahre nach dem Tod des Tagesspiegel-Mitgründers wurden die Notizen wieder entdeckt – wir dokumentieren Auszüge.

Etliche deutsche Politiker stemmen sich vehement gegen einen Schuldenschnitt für die Griechen. Dabei wird oft vergessen: Auch Deutschland wurden einst viele Milliarden erlassen.
öffnet in neuem Tab oder Fenster