
© s
Apps für Smartphones: Konferenz mit grünen Schweinen
Die Welt der Apps als Ablenkung und Subversion: Wie putzige digitale Geschicklichkeitsspiele den Arbeitsalltag verändern. 21 Millionen Deutsche spielen laut IT-Branchenverband BITKOM regelmäßig.
Gegen den Spieltrieb hat das Christentum grundsätzlich nichts einzuwenden. „Sagen oder Tun, in dem nur eine seelische Freuung gesucht wird, nennt man Spiel oder Scherz“, schreibt Thomas von Aquin um 1270 in seiner „Summa Theologica“. Gegen solche Seelenerfreuung sei nichts einzuwenden: „Es ist notwendig, zuweilen derlei zu gebrauchen, sozusagen zu einer gewissen Beruhigung der Seele.“
Die säkularisierte Digitalgesellschaft sieht das ähnlich. 21 Millionen Deutsche spielen laut IT-Branchenverband BITKOM regelmäßig am PC, am Fernseher, an Konsolen oder Smartphones. Entsprechend solide sind die dazugehörigen Umsatzzahlen: Rund 2,3 Milliarden Euro wurden 2010 in Deutschland für Spielkonsolen und Spielesoftware ausgegeben. Vor allem der Smartphone-Markt macht der Branche große Freude: „Es herrscht wieder richtige Goldgräberstimmung“, sagt Tom Kubischik, Spieleentwickler bei der Berliner Firma Morgen Studios. Dank iPhones, iPads und anderer TouchscreenGeräte boomt eine neue Generation von Spielen. Und erreicht sogar die ältere, bürgerliche Kundschaft.
Die Zeiten, als Rumdaddeln noch als „Gehirnjogging“ getarnt werden musste, sind vorbei. „Angry Birds“, „Doodle Jump“, „Fruit Ninja“, „Cut the Rope“ heißen die weltweiten Hits der letzten Monate, es sind sogenannte Casual Games, kurze Gelegenheitsspielchen mit hohem Suchtfaktor, erhältlich für lächerliche 79 Cent. „Der Preis ist eines der Erfolgsrezepte“, erklärt Kubischik, „aber wichtig ist auch der absolut hürdenlose Einstieg.“ Blitzschnell müsse der Nutzer das Spiel runterladen, verstehen und starten können. Dazu kommt die Steuerung ohne jedes Hilfsmittel. Pens, Sticks oder Buttons braucht man nicht mehr, gespielt wird durch Hin- und Herbewegen des Geräts oder durch Berühren des Screens.
Auf dem Smartphone kann man überall unauffällig spielen
„Doodle Jump“ zum Beispiel. Da springt ein kleines pummeliges Etwas mit einer samsartigen Rüsselnase von Scholle zu Scholle, dirigiert lediglich durch sanftes Ruckeln am Smartphone. Höher und höher springt es, manchmal auch daneben, dann ist das Spiel aus. Ähnlich simpel gestrickt ist „Fruit Ninja“, wahllos fliegen hier Äpfel, Melonen, Bananen in die Luft, mit einem beherzten Fingerstreich müssen sie zerschnitten werden. Das spritzt dann schön und gibt ordentlich Punkte. Intellektuell herausfordernd ist es eher nicht.
„Die scheinbare Schlichtheit ist ein wichtiges Stilmittel“, erklärt Designer Kubischik, „genauso wie die Niedlichkeitsästhetik.“ Daher die vielen putzigen Pummelfiguren, der kindliche Comiclook, die Holzhammer-Symbolik. Buntes Obst: gut, schwarze Bomben: schlecht. Der Nutzer schätzt laut Kubischik genau diese Reduktion von Komplexität, „was nicht heißt, dass er sich mit einfallslosen Spielverläufen zufrieden gibt“. Die Qualität der Games liegt in den Details, in kleinen ironischen Brechungen, in immer neuen Einfällen, die das scheinbar gleichförmige Spiel minimal variieren. Der Doodler hüpft mal durch Schneegestöber und mal durch Blumenwiesen, mal hilft ihm winziger Propellerhut, mal wollen ihn fiese grüne Männlein in den Abgrund schupsen. Nicht selten glaubt man das Kichern der Designer über ihre albernen Einfälle nachhallen zu hören.
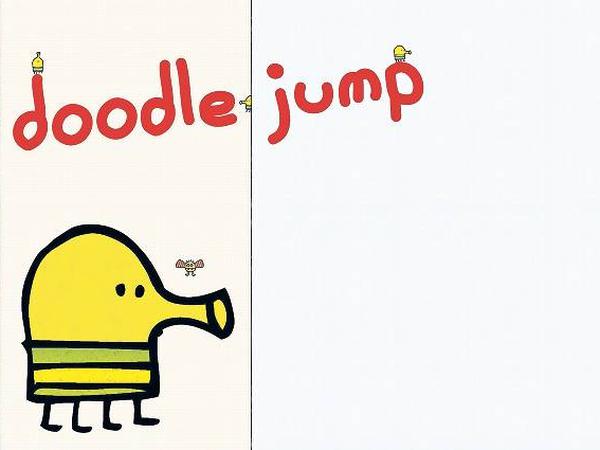
© s
Sieger der Herzen – und Bilanzen – sind allerdings zwei Spiele, die neben Schlichtheit und Niedlichkeit noch ein weiteres Stilmittel ausschöpfen: „Angry Birds“, bei dem komische Kugelvögel mit einer Zwille auf grüne Schweine geschossen werden (weil die die Vogeleier gestohlen haben), und „Cut the Rope“, bei dem ein schillerndes Bonbon an Seilen baumelt. Diese beiden Spiele vermischen die Simulation von Schwerkraft mit der Faszination des sensorisch hochsensiblen Smartphones. Von Level zu Level verlangen die Spiele ihren Nutzern mehr Fingerspitzengefühl und physikalisches Vorstellungsvermögen ab. Wie muss ich die Schleuder spannen, damit das Vogelgeschoss im richtigen Winkel auftrifft? Bis wohin muss das Seil schwingen, damit das Bonbon die perfekte Fallposition hat? Das ist allerdings hochgradig knifflig.
Ihren durchschlagenden Erfolg verdanken die Casual Games aber nicht nur den taktilen Reizen, sondern auch ihren bescheidenen Ansprüchen an Zeit und Aufmerksamkeit. Anders als bei den auf langfristiges emotionales und finanzielles Engagement angelegten Social Games wie „Farmville“ oder „Cityville“ sind die Aufgaben überschaubar, die Level oft frei wählbar, Folgekosten gibt es nicht. Damit passen die Spiele perfekt in die kleinen urbanen Zeitfenster, in S-Bahnen, Wartezimmer oder Flughäfen.
Der Erfolg deutet auf den kindlichen Spieltrieb von Erwachsenen hin
Auch auf Sitzungen und in Konferenzen lässt sich das unauffällig bewerkstelligen. Wer unterm Tisch am Smartphone rumfummelt, gilt immer noch als engagierter Multitasker, als besonders produktiver und vernetzter Kollege. Genau dafür waren das mobile Netz und seine ersten Endgeräte, allen voran das Manager-Blackberry, ja ursprünglich gedacht: zur Optimierung der eigenen Arbeitskraft.
Always online, das ist kein Vergnügen, sondern eine Mischung aus Auszeichnung und Verantwortung. Kein Fitzelchen Lebenszeit sollte ungenutzt bleiben. Der high performende Arbeitnehmer hat bitteschön erreichbar, produktiv, informiert, konzentriert zu sein – und zwar rund um die Uhr.
Der Erfolg der Casual Games deutet womöglich auf mehr hin als auf den kindlichen Spieltrieb von Erwachsenen. Vielleicht ist, was wie eine kleine Alltagsflucht aussieht, ja die subversive Antwort auf einen übersteigerten Optimierungsanspruch. Ich spiele, um mich zu entziehen. Und Steve Jobs hilft mir netterweise dabei. „iPhone und iPad unterlaufen die mobile Arbeitsmoral auf jeden Fall“, meint Tom Kubischik, „das sind ausdrücklich Entertainment-Geräte, nicht zum effizienten Arbeiten gedacht, sondern zum Amüsieren und Konsumieren.“ Es geht nicht um Selbstausbeutung, sondern um Selbstbespaßung.

© s
Und damit auch um viel Geld. Denn einen Hit im App Store landen nur die wenigsten Spieleanbieter. Rund 400 000 Apps sind zurzeit auf dem Markt, ein unüberschaubares Angebot. Entsprechend selten gelingt es, überhaupt ins Bewusstsein der breiten Masse vorzustoßen. Die meisten neuen Spiele gehen sang- und klanglos unter. Umgekehrt gilt: Was einmal im Ranking oben ist, wird zum Selbstläufer – der Ablauf ist nicht anders als auf dem Buchmarkt oder im Musikbusiness.
„Jeder in unserer Branche schielt daher ständig auf die Platzierung im App Store“, gibt Tom Kubischik zu. Und ähnlich wie bei Amazon wird beim Verfassen von Rezensionen kräftig nachgeholfen, das ist ein offenes Geheimnis. Aber trotz aller viralen Marketingbemühungen: Der Erfolg lässt sich nicht planen. „Macht uns doch auch mal so was wie Moorhuhn“, bekamen die Designer bei Morgen Studios von ihren Auftraggebern ständig zu hören. Moorhuhn, das war der Daddelspaß des Jahres 1999, bis heute der einzige wirkliche Casual-Game-Knüller made in Germany. Inhalt: drollige kleine Vögel abschießen. Aber trotz aller bekannten Zutaten, „das ultimative Rezept für einen Bestseller kennt niemand“, meint Kubischik. Jetzt sind kleine Vögel selbst die Wurfgeschosse, aber womit werden die Smartphone-Besitzer nach „Angry Birds“ spielen wollen: mit schnurrenden Kätzchen? Klebrigen Lutschern? Fliegenden Teppichen?
Ob das alles wirklich so arbeitskraftschädigend ist, wie es aussieht, weiß man nicht so genau. Der menschliche Geist ähnelt einem Pfeil und Bogen, konstatierte Thomas von Aquin. Wenn er permanent angespannt wird, bricht er schneller. Aristoteles war ähnlicher Ansicht: Man müsse sich vergnügen, „damit man sich ernsthaft betätigen kann“. Glück allerdings, mahnte der Philosoph, finde man in den flüchtigen Belustigungen nicht. Weil „das glückliche Leben in der Betätigung der Gutheit besteht. Dieses Leben ist mit ernsthafter Bemühung verbunden und besteht nicht in der Vergnügung“. Aber das ist bloß die unmaßgebliche Meinung eines antiken Spielverderbers.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false