
© Reuters
Countdown zur US-Wahl: Noch 24 Tage: Romneys Europa
Inhaltlich steht Mitt Romney Angela Merkel näher, als Barack Obama das tut. Doch ein Regierungswechsel in Washington D.C. würde europäische Interessen auf vielen Gebieten betreffen - und Romney hat das Potential, die Welt zu verändern.
Wer als Amerikaner vor 30 Jahren nach Deutschland reiste, wurde mit drei Dingen konfrontiert – der deutschen Vergangenheit (Hitler), der deutschen Rückständigkeit (keine air condition) und dem deutschen Pazifismus (Friedensbewegung). Wer als Deutscher vor 20 Jahren nach Amerika reiste, dem wurde zur Wiedervereinigung gratuliert. Wer vor zehn Jahren kam, dem wurde Undankbarkeit vorgeworfen, weil er sich trotz Marschallplans nicht am Irakkrieg beteiligen wollte. Und wer heute kommt, ist ein Sozialist. Jedenfalls in Teilen des Landes.
Europa und Sozialismus: Das ist in amerikanischer konservativer Rhetorik fast zum Synonym geworden. Europäer haben die längsten Ferien (Deutschland), die meisten Schulden (Griechenland), die höchsten Steuern (Skandinavien), die mächtigste Bürokratie (Brüssel). Die Sowjetunion hat als Feindbild ausgedient, die „Achse des Bösen“ zerbröselt, jetzt konzentrieren sich die Abwehrkräfte darauf, aus Amerika ein großes Europa machen zu wollen.
Mitt Romney hat als junger Mann und Missionar für die Mormonen zwei Jahre lang in Frankreich gelebt. Er spricht Französisch, ist mit europäischer Lebensart vertraut. Dennoch lässt sich aus seinen Äußerungen nur mittelbar, nicht unmittelbar ableiten, was er als US-Präsident für Europa bedeuten würde. Denn der Alte Kontinent dient ihm bislang vor allem als Negativ-Metapher, die er auf die regierende Administration von Barack Obama projiziert. Der Republikaner meint damit kreditfinanzierte Investitionsprogramme, regulative Eingriffe in den Wirtschaftskreislauf, ausufernde Staatsbefugnisse, wachstumshemmende Klimaschutzgesetze. All das ist ihm ein Gräuel.
Inhaltlich steht Romney daher in vielerlei Hinsicht Angela Merkel näher, als Obama es tut. Dessen Regierung wurde nie müde, von Deutschland noch mehr steuerfinanzierte Investitionsprogramme oder etwa die Einführung von Eurobonds zu fordern. Obama war ein Keynes, Romney würde eher ein Anti-Keynes. Das heißt: Ausgabenkürzungen, Haushaltskonsolidierung, keine höheren Steuern. Und: keine Bankenregulierung.

© Tsp
Allerdings wären europäische Interessen durch einen Regierungswechsel in Washington D.C. auch auf vielen anderen Gebieten betroffen. Guantanamo würde weiterhin nicht geschlossen, Drohnenangriffe auf mutmaßliche Terroristen unvermindert fortgesetzt, der globale Klimaschutz vollends negiert. Und zweifellos bliebe sich Amerika bei zwei seiner gesellschaftlichen Großthemen, die Europäern ein stetes Unbehagen bereitet, treu – der Todesstrafe und dem Recht auf Waffenbesitz. Insofern wäre der transatlantische Diskurs nicht vor einem Rückfall in jene Stereotype gefeit, die bereits zu Zeiten von Ronald Reagan und George W. Bush gepflegt wurden.
Romney hat angekündigt, eine eher interventionistische als isolationistische Außenpolitik zu betreiben. In China und Russland sieht er Widersacher, die Opposition in Syrien möchte er gezielt bewaffnen, den amerikanischen Abzug aus dem Irak verurteilt er als verfrüht, sein bester Freund im Nahen Osten ist Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu.
„Hoffnung ist keine Strategie“, sagte Romney vor wenigen Tagen in seiner außenpolitischen Grundsatzrede im „Virginia Military Institute“ in Lexington. Das war an die Adresse Obamas gerichtet. In der Tat liest sich dessen Bilanz im Nahen Osten nicht gerade gut. Terror und Tumulte in Libyen, Krieg in Syrien, Chaos in Ägypten, Islamisten auf dem demokratischen Vormarsch, Anschlagsserien im Irak, Taliban-Rückkehr in Afghanistan, Nahost-Frieden zwischen Israel und den Palästinensern in weitester Ferne, und der Iran steht kurz vor entscheidenden Durchbrüchen in seinem Atomprogramm.
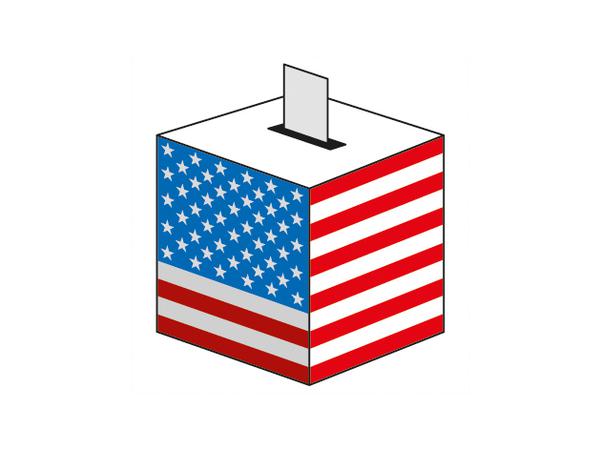
© Tsp
Allerdings ist es leicht, diese Entwicklungen abstrakt als „Folge fehlender amerikanischer Führung“ zu kritisieren, aber schwer, konkrete Alternativen zu benennen. Er wolle „Frieden durch Stärke“ bringen, sagt Romney. Aber er weiß auch, dass die Amerikaner es leid sind, noch länger die undankbare Rolle des Weltpolizisten zu übernehmen. Das „Raus-da-Lager“ auch unter Republikanern ist größer geworden. Zumal teure Kriege den Haushalt belasten. Militärische Interventionen laufen einem der obersten innenpolitischen Ziele der Konservativen, der Haushaltskonsolidierung, zuwider.
Praktisch ist Romney daher in außenpolitischer Hinsicht ein Reagan ohne Geld und ein Bush ohne Rückhalt. Die Sachzwänge pressen ihn in eine größere Kontinuität zur Außenpolitik Obamas, als der Herausforderer durch seine gelegentlich markante Rhetorik suggerieren möchte. Insbesondere im Nahen Osten – aber auch bezüglich der europäischen Schuldenkrise - werden Amerikas Einflussmöglichkeiten ohnehin oft überschätzt.
Das Amerika, das Romney meint, wenn er es gegen Europa wendet, hat er vor zweieinhalb Monaten - nach seiner Reise nach Israel, Polen und Großbritannien - in einem kleinen Aufsatz mit dem Titel „Culture Does Matter“ für den „National Review“ so beschrieben: „Unsere Arbeitsmoral, unsere Hochschätzung der Erziehung, unsere Risikobereitschaft, unsere Würdigung von Ehre und Eid, unsere Familienorientierung, unsere Hingabe an ein Ziel, das größer ist als wir selbst, unser Patriotismus.“ In dem Maße, wie ein Präsident Romney diese Ideal beleben und wieder beleben würde, könnte er Amerika und die Welt verändern.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false