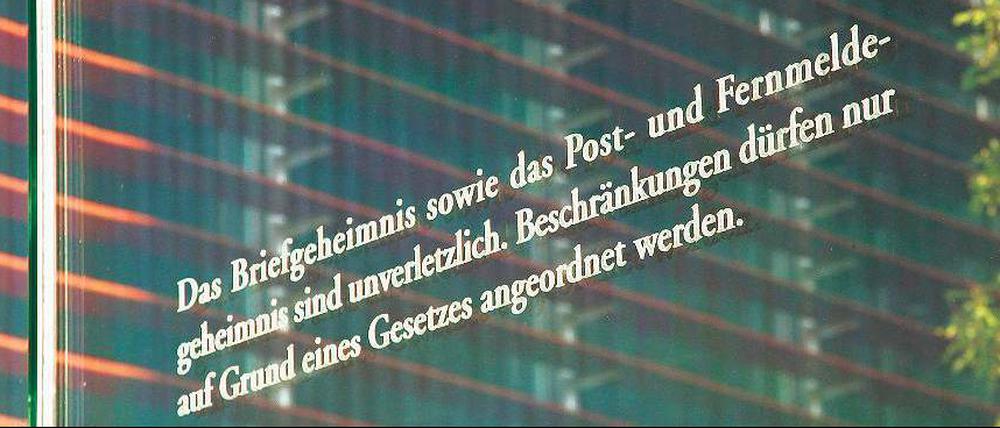
© dpa
NSA-Spähaffäre: Thomas Oppermann: Vom Verteidiger zum Chefankläger
Kein Oppositionspolitiker hat in der Spähaffäre mehr Angriffe gefahren als Thomas Oppermann – früher nahm der selbstbewusste SPD-Politiker die deutschen Dienste gegen Verdächtigungen in Schutz. Jetzt fährt er eine andere Strategie, und die ist wohlkalkuliert.
Stand:
Wenige Stunden nach der Niederlage der SPD im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) hatte Thomas Oppermann wieder zu alter Form gefunden. Mit freundlichem Lächeln und offenem Blick versuchte der SPD-Parlamentsgeschäftsführer in der abklingenden Erregung die Glaubwürdigkeit seiner Partei zu retten. „Wir haben noch nicht alles aufgeklärt, was aufzuklären ist“, erklärte er am Montagabend in den „Tagesthemen“.
Wahrscheinlich hat kein anderer deutscher Politiker in diesem Sommer zum NSA-Komplex mehr Presseerklärungen herausgegeben und mehr anklagende Sätze in Kameras und Mikrofone gesagt als der frühere Verwaltungsrichter. Jeder Satz war stets penibel vorbereitet, so dass er nach dem Kollaps der Hauptvorwürfe der Opposition wohl kaum eine einzelne Behauptung zurücknehmen muss. Doch mit starken Wertungen wie der, die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin sei „bis ins Mark“ erschüttert, erzeugte er den Eindruck, die Regierung vertusche einen ungeheuren Skandal und der Bundesnachrichtendienst sei williger Helfer der USA beim massenhaften Ausspähen.
Ein fast atemberaubender Rollenwechsel
Aus der Union wurde ihm deshalb vorgeworfen, er missbrauche seine Funktion als PKGr-Vorsitzender, um Wahlkampf zu machen und das Vertrauen der Bürger in die Sicherheitsbehörden zu untergraben. Tatsächlich hat Oppermann im Vergleich zu seiner parlamentarischen Anfangszeit in Berlin einen fast atemberaubenden Rollenwechsel bewerkstelligt. Im BND-Untersuchungsausschuss betätigte sich der Jurist vom Frühjahr 2006 bis Herbst 2007 als Chefverteidiger des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Anders als heute nahm er damals den Bundesnachrichtendienst stets gegen massive Verdächtigungen von FDP, Linkspartei und Grünen in Schutz.

© dpa
Weder an Selbstbewusstsein noch an Machtinstinkt fehlt es dem 59-Jährigen. Als das Mitglied von Peer Steinbrücks Wahlkampfteam kürzlich einen „Masterplan“ in Berlin gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorstellte, beanspruchte er wie nebenbei das Amt des Bundesinnenministers. „Diese Dinge brauchen eine starke Führung“, meinte er: „Das würde ich schnell in Angriff nehmen.“
Doch in der eigenen Fraktion hat Oppermann nicht nur Freunde, weshalb er bei seiner letzten Wiederwahl 2011 auch nur 64,4 Prozent erhielt. Vor allem auf dem linken Flügel gibt es Abgeordnete, die ihn für zu alert, zu überheblich und auch für zu anpassungsfähig halten. Tatsächlich vollzieht der Jurist Kurswechsel am liebsten, ohne davon viel Aufhebens zu machen. So hatte er vor der Ausrufung von Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat auf seinen eigenen Favoriten gesetzt, und der hieß Frank-Walter Steinmeier.
Von Gerhard Schröder gelernt
Oppermann gilt weit über seine eigene Partei hinaus als moderner Politiker, und das nicht nur, weil er mit seiner stets freundlichen Entschiedenheit bei Fernsehauftritten eine gute Figur macht. Der SPD-Politiker folgt nicht nur seinen eigenen Überzeugungen, sondern kalkuliert die Wirkungen seiner Angriffe genau. So machte er in der Affäre um den angeschlagenen Bundespräsidenten Christian Wulff dessen Ruhestandszahlungen nicht deshalb zum Thema, weil er darin einen Skandal sah, sondern weil viele SPD-Abgeordnete berichteten, in ihren Wahlkreisen empöre das Thema viele Menschen. Mit Wulff verband ihn zumindest bis dahin ein gutes persönliches Verhältnis.
Den Umgang mit emotional aufwühlenden Themen hat Oppermann womöglich von dem Politiker gelernt, der ihn im Frühjahr 1998 zum niedersächsischen Kultusminister gemacht hatte. Gerhard Schröder nahm mittelgroße Kollateralschäden oder gar Kritik aus den eigenen Reihen gerne in Kauf, wenn er sicher war, mit zugespitzten oder überspitzten Thesen den Nerv der Wähler zu treffen. Auch dank dieser kommunikativen Frechheiten brachte er es ziemlich weit. Falls der Göttinger es seinem ehemaligen Chef gleichtun wollte, müsste er sich allerdings beeilen: In Oppermanns Alter war Schröder längst Bundeskanzler.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: