
In der Bildungspolitik heißt die Forderung noch immer und immer wieder: „Mehr Geld“. Doch das ist falsch. „Mehr und vernünftigeres Engagement“ ist die richtige Forderung.

In der Bildungspolitik heißt die Forderung noch immer und immer wieder: „Mehr Geld“. Doch das ist falsch. „Mehr und vernünftigeres Engagement“ ist die richtige Forderung.

Deutschlands neue Regierung feiert die Industriekultur in Deutschland - und schaut gleichzeitig seelenruhig deren Niedergang zu. Die Industrie wendet sich ab - auch weil Union und SPD meinen, sie hätten besseres zu tun.

Die große Koalition ist noch nicht im Amt. Doch bereits jetzt zeigt sich: Ihre erdrückende Mehrheit verhindert wirkliche Debatten. Es wird niedergedröhnt statt argumentiert.

Dem Land geht's gut, die Konjunktur läuft. Das haben wir tüchtigen Beamten zu verdanken, die weiter arbeiten, wenn die Politik wochen- und monatelang gelähmt ist.

Die Gefährdungen des deutschen Geschäftsmodells von innen werden nicht registriert. Im Gegenteil, sie werden fröhlich vorangetrieben
Wer arbeitet, soll von seiner Hände Arbeit leben können. Das ist Konsens bei den Verhandlern von SPD und Union.

Bücher kosten immer weniger, Journalismus oft gar nichts mehr - nicht erst sei dem Start der "Huffington Post". Bezahlen werden am Ende die, die umsonst lesen. Weil sie sich auf Informationen nicht mehr verlassen können.

Seit dem vergangenen Sonntag sind nur noch Sozialdemokraten im Bundestag. Wenn wir das vorher klar gewesen wäre, hätten wir die Trümmertruppe von Herrn Rösler vielleicht doch lieber noch ein Weilchen behalten.
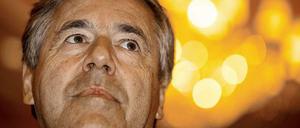
Menschen, die bedeutend sind, verändern sich. Bei manchen kommt Hybris dazu. Das mag man bedauern. Doch ohne solche Menschen geht es nicht. Lehmschicht ist noch gefährlicher.

Die Kandidaten auf ihren Wahlplakaten sind kaum wiederzuerkennen: Die FDP hat bei Rainer Brüderle und Guido Westerwelle die Spuren verwischt. Das soll wohl signalisieren: Wir tun nichts Böses, wir bringen Gutes. Aber es ist das Zeichen einer Partei, die sich ihrer Inhalte nicht mehr sicher ist.

Früher wollte Angela Merkel Deutschland dienen. Heute will sie gemocht, bewundert, verehrt werden. Das ist zwar ihr gutes Recht - ist aber beängstigend.
Bei Siemens wurden Fehler gemacht, der größte davon: die Wette auf die deutsche Energiepolitik. Die Investitionen in Sonne und Wind zahlten sich nicht aus. Inzwischen gehört Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen.

Es ist paradox: Immer mehr Kinder gehen auf Privatschulen, doch ihre Eltern wollen sich immer weniger dazu bekennen. Dabei spricht nichts dafür, dass öffentliche gegenüber privaten Schulen benachteiligt werden.

Hohe Geldbeträge dienen in Europa als politische Signalflaggen dafür, wie ernst ein Thema genommen wird. Im Fall der Jugendarbeitslosigkeit aber vermitteln sie das falsche Signal. Sie ermutigen die jungen Leute, zu Hause zu warten.

Dass eine säkulare Gesellschaft die normative Kraft des Faktischen anerkennt, ist vermutlich vernünftig. Dass aber die Kirche von ihren Gläubigen nicht mehr erwarten will, sich vor Gott und den Menschen zum Zusammenleben zu bekennen, ist verrückt.
Ein Land, dem nicht mehr die kühle Analyse als Maß für das politische Handeln gilt, sondern der soziale Windchill-Faktor, verliert den Sinn für die Realität.

Der Softwarekonzern SAP will mehr Autisten einstellen, weil diese gut mit Zahlen umgehen können. Im Moment haben es Menschen mit Besonderheiten leicht auf dem Arbeitsmarkt. Doch das bleibt eine Ausnahmeerscheinung.

Die Vereinbarungen zur Stärkung der Fiskaldisziplin in Europa sind gescheitert. Das wird auch in Deutschland politische Folgen haben.

Nicht nur Manager, auch Spitzensportler können Millionen verdienen. Doch das regt uns kaum auf. Warum wir es erträglicher finden, dass Ballspieler klotzig verdienen, als wenn das Betriebswirte tun.

In Berlin kursieren abenteuerliche Einwohnerprognosen und die Stadt will mehr Wohnraum schaffen. Dabei denkt kaum jemand an die Vorteile, die Berlins menschenleeres Umfeld liefert - gäbe es denn bessere Verbindungen dorthin.
In der Euro-Krise werden Nazi-Stereotype hervorgekramt, jetzt wieder in Zypern. Das ist zwar verletzend und ungerecht. Doch die Deutschen müssen die Richtung angeben – und da hilft es mehr, als dass es schadet, wenn die Südeuropäer der Kanzlerin den Bart anmalen dürfen.
Angeblich steckt der Kapitalismus in der Krise. Doch die Aktien sind weltweit in der Nähe neuer Höchststände. Wie passt das zusammen?

Es hatte alles so schön angefangen: Deutschland - das einzige Land der Welt, das Verantwortung für den Globus übernimmt. Aber inzwischen zeigt sich: Die Kalkulation der Energiewende geht gar nicht auf.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern, Theologen, Politikern und Betriebsräten fordert die Einführung der 30-Stunden-Woche. Dabei sind die Menschen nicht unzufrieden, weil sie zu lange arbeiten müssen - sondern weil sie zu wenig verdienen.
öffnet in neuem Tab oder Fenster