
Zerrissen zwischen analog und digital: Berit Glanz begibt sich mit ihrem Debütroman „Pixeltänzer“ in die Welt der Start-ups.

Zerrissen zwischen analog und digital: Berit Glanz begibt sich mit ihrem Debütroman „Pixeltänzer“ in die Welt der Start-ups.

In Tara Isabell Burtons Debüt „So schöne Lügen“ wird das Smartphone zur Spannungsmaschine.

Das paradoxe Verhältnis von innerer und äußerer Freiheit: Svenja Gräfen erzählt in „Freiraum“ von den Illusionen der Generation Y.

Von der Erziehung der Gefühle und ihrem Scheitern: Julian Barnes’ großartig erzählter Roman „Eine einzige Geschichte“.

Der Roman zum Brexit, zur Stunde. Oder doch mehr Game of Thrones? John Lanchesters Roman „Die Mauer“ zeigt die totale Düsternis.

Anleitung zum Unglücklichsein: In der Kurzgeschichtensammlung „Männer, die sich schlecht benehmen“ erzählt Joshua Ferris von Großstadtneurotikern und anderen Narzissten.

Warum wählt jemand den Weg der Selbstzerstörung? In „Die Überwindung der Schwerkraft" erzählt Heinz Helle eine Brüder-Geschichte von großer emotionaler Wucht.

Schriftsteller und Tagesspiegel-Autor Kolja Mensing erzählt in „Fels“ einfühlsam und präzise vom Schicksal eines jüdischen Viehhändlers im Zweiten Weltkrieg.

Porträt des Kritikers als junger Mann: Dirk Knipphals’ literarisches Debüt „Der Wellenreiter“ ist ein klug erzählter Generations- und Künstlerroman.

Favorit beim Deutschen Buchpreis: Das Romandebüt „Hier ist noch alles möglich“ der Schweizer Autorin Gianna Molinari erzählt von Migration und Wölfen.

Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu musste für ein Gedicht ins Gefängnis. Heute lebt er in Berlin. In "Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass" schildert er das Drama seiner Flucht.

Literatur als existentialistische Meditation: Hans Platzgumers neuer Roman „Drei Sekunden jetzt“ ist packend und präzise geschrieben. An den glänzenden Vorgänger reicht er trotzdem nicht heran.

Wenn die häusliche Idylle zum Alptraum wird: Samanta Schweblins preisgekrönte Erzählsammlung „Sieben leere Häuser“ ist abgründig und meisterhaft.
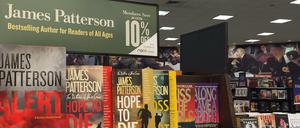
Der Germanist Jörg Magenau untersucht in „Bücher, die wir liebten“ das Geheimnis des Bestsellers von der Nachkriegszeit bis heute. Er zeigt: Der Erfolg eines Werkes verrät viel über die Zeit.

Polit-Groteske oder Wunschfantasie? Alexander Schimmelbusch will mit seinem Roman „Hochdeutschland“ eben dieses Land vor dem Untergang retten.

Geschichten über Begehren, Missbrauch, Macht und Kunst. Die amerikanische Autorin April Ayers Lawson debütiert mit „Jungfrau und andere Stories“.

Kurz vor der Deportation ins KZ kam für Henny Brenner die Rettung: Bomben der Alliierten fielen auf Dresden. Ihr Erinnerungsbuch offenbart die Widersprüche und Absurditäten des NS-Alltags.

Der Wirklichkeit trotzen: Sophie Divry mokiert sich in ihrem hochamüsanten Metaroman „Als der Teufel aus dem Badezimmer kam“ über das eigene Elend.

Selbstwerdung eines englischen Dienstmädchens: Graham Swifts meisterlicher Roman „Ein Festtag“.

"Wollten wir nicht ein Buch schreiben?" Mit Helden, Action und all dem Gedöns? Nein, lieber surreal und kauzig: Hermann Peter Piwitts Erzählungsband „Drei Freunde“.

Zwischen traditioneller Bildung und neuer digitaler Welt: Jonas Lüscher erzählt in „Kraft“ vom Scheitern eines Schwaflers - ein hochkomischer, philosophischer Roman.

Ganz in der Gegenwart: Die Szene-Autorin Julia Zange begibt sich mit ihrem Roman „Realitätsgewitter“ in die digitale Wärmestube der sozialen Netzwerke.

In seinem biografisch angehauchten Romandebüt „Umbruch“ erzählt der Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier von den Glanztagen des Feuilletons - und den Anfängen seines Untergangs.

Wirklichkeit oder Fiktion, metaliterarisches Spiel oder Psychothriller? Delphine de Vigan verteidigt die Imagination – in einem erfundenen Tatsachenbericht.
öffnet in neuem Tab oder Fenster