Wieder leben wir in Zeiten, in denen die Politik nach Karlsruhe ausgewandert zu sein scheint. Da kann man leicht die Übersicht darüber verlieren, an wie vielen Stellschrauben der Politik die Richter gerade drehen.
Robert Leicht

Wieder leben wir in Zeiten, in denen die Politik nach Karlsruhe ausgewandert zu sein scheint. Da kann man leicht die Übersicht darüber verlieren, an wie vielen Stellschrauben der Politik die Richter gerade drehen.
Es ist wie in Rilkes Gedicht „Das Karussell“: „und dann und wann ein weißer Elefant.“ In ähnlicher Regelmäßigkeit taucht das Thema „Volksentscheid“ in der bundespolitischen Verfassungsdebatte auf.

Der Finanzminister hat einen Volksentscheid über Europa vorhergesagt. Nur - worüber genau soll eigentlich entschieden werden? Die Sache ist viel komplizierter, als Schäuble es aussehen lässt.
Schön wär’s, aber vollkommen utopisch, wenn in der Politik alle Akteure, die Bürger eingeschlossen, nur sachgerecht diskutieren und entscheiden würden. Was aber die Bundestagsparteien derzeit unter dem Stichwort „Finanztransaktionssteuer“ aufführen, ist nur noch zynisch oder lächerlich zu nennen, ein Satyrspiel zur allgemeinen (Selbst-)Irreführung.

Was Politiker aller Parteien derzeit unter dem Stichwort "Finanztransaktionssteuer" aufführen, ist Realsatire, meint unser Autor. Eigentlich wissen alle, dass die Steuer nichts bringt. Und machen trotzdem munter weiter.
Der neue Bundespräsident Joachim Gauck hat noch nicht einmal die hundert ersten Tage im Amt verbracht, die man jedem neuen Amtsinhaber kritikfrei zugesteht, nun hat er denkbar schwierige Auslandsreisen absolviert. Und schon macht sich das Kommentariat über seine Äußerungen her.

Die Deutschen wollten einen Präsidenten mit einem eigenen Kopf, einen, der sagt, was er denkt. Sie wollten Gauck - und nun ist es auch wieder nicht recht.
Wenn es allein um die pragmatische Seite des sogenannten Betreuungsgeldes für Familien ginge, in denen die Kinder zu Hause betreut werden, könnte man die Angelegenheit einigermaßen entspannt diskutieren. Doch abgesehen von den parteipolitischen Schachzügen stören mich die ideologische Begleitmusik sowie die eingestreuten Untertöne von Hohn und Spott.

Wenn es allein um die pragmatische Seite des sogenannten Betreuungsgeldes für Familien ginge, in denen die Kinder zu Hause betreut werden, könnte man die Angelegenheit einigermaßen entspannt diskutieren. Doch abgesehen von den parteipolitischen Schachzügen stören mich die ideologische Begleitmusik sowie die eingestreuten Untertöne von Hohn und Spott.
Es ist ja nicht nur Schleswig-Holstein! Wohin man nach diesem Wahlwochenende schaut – fast überall wird die Lage noch komplizierter.
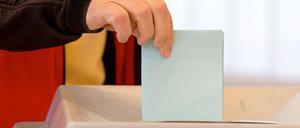
Das politische System in Deutschland muss mehr Parteien und weniger Wähler verkraften. Erleben wir das Ende einer Ära?
Die Bundesrepublik hat ja einige Erfahrungen mit der Gründung neuer Parteien – nicht nur mit jenen kuriosen Vereinigungen, die unsere Stimmzettel unübersichtlich verlängern, sondern auch mit Parteien, die den Sprung in die Parlamente schaffen. Auch im Bundestag war 1983 endgültig Schluss gewesen mit dem althergebrachten Dreiparteienspiel, an das man sich seit 1961 gewöhnt hatte: Die Grünen waren drei Jahre nach ihrer Gründung angelangt.

Jede Partei braucht ein großes historisches Thema. Doch bei der Piraten-Partei ist ein überwölbendes Thema nicht zu erkennen, meint Robert Leicht. Bei den Grünen war das damals anders. Ein Rückblick.
Da wundern sich nun viele, dass die Piratenpartei einen kleinen kometenhaften Aufschwung hinlegt. Einfach, weil sie anders ist als die anderen – und irgendwie „interessant“.
Bundestagspräsident Norbert Lammert ist für seine eigene Partei, die CDU, oft unbequem, erteilt auch Abweichlern im Parlament das Wort. Lammerts Spielräume sollen nun eingeschränkt werden. Lasst sie doch reden!
Dieses Mal also Kurt Beck, der langgediente Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz! Wieder einmal will ein Regierungschef relativ kurz nach seiner Wiederwahl vorzeitig einem Nachfolger Platz machen.

Kurt Beck räumt seinen Posten als Ministerpräsident noch vor Ende der Legislaturperiode. Der fliegende Wechsel an der Spitze hat Methode. Doch wenn die Wähler nicht mitspielen, könnte der Schuss nach hinten losgehen.
Das Internet ist unser Schicksal! So können wir das legendäre Wort Walther Rathenaus über die alles bestimmende Bedeutung der Wirtschaft abwandeln – oder ergänzen.
Erlebt die Demokratie durch das Internet einen Aufschwung? Im Gegenteil: Es dominieren Häme, Herabsetzung, Beschimpfung, Verleumdung.
W enn die nahtlos ineinander übergehenden Auseinandersetzungen erst um Christian Wulff, dann um Joachim Gauck eines gezeigt haben, dann dies: So irrelevant kann das Amt des Bundespräsidenten nun wahrlich nicht sein, dass man es gleich in Bausch und Bogen abschaffen könnte – wie es so mancher Spaßvogel oder Staatsverächter unterdessen behauptet hatte. In aller ihrer Gegensätzlichkeit – bei Wulff konnte die Wertschätzung schließlich kaum noch tiefer fallen, bei Gauck konnte sie kaum noch überhöht werden – zeigen die beiden Diskurse, und zwar ungeachtet aller medialer Überreizungen, dass es doch ein Bedürfnis gibt nach einer Person an der Spitze unseres Gemeinwesens, zu der man entweder achtungsvoll aufschauen oder auf die man im Bedarfsfall wenigstens verachtungsvoll herabschauen kann: So oder so „fühlt sich“ der Herr Staatsbürger einfach besser, vor allem kollektiv.
Warum soll nicht auch ein mit knappster Mehrheit gewählter Bundespräsident überzeugend wirken? Auch um das höchste Amt sollte es einen Wettbewerb geben.
Mitte Januar, ein Abend in Berlin, auf einem der vielen vermeintlichen Höhepunkte der Krise um Bundespräsident Christian Wulff: Eine große deutsche Tageszeitung – Name tut nichts zur Sache – feiert mit Hunderten von Gästen eine lange Nacht am Pariser Platz, mit Schampus und weniger teuren Getränken sowie schönen Speisen satt. Natürlich reden fast alle irgendwann teils ehrlich kritisch, teils lustvoll hämisch über die leicht korruptös gesponserte Republik und natürlich über die Affäre des Bundespräsidenten.
Die Jagd auf Wulff wird selber zur Affäre. Christian Wulff sollte danach beurteilt und auch kritisiert werden, was er im Amt des Bundespräsidenten tut - unter seine Zeit als Ministerpräsident sollte aber endlich ein Strich gezogen werden.