
© Thilo Rückeis
Griechenland und Flüchtlinge: "Deutschland ist für das Chaos verantwortlich"
Sagt Joseph E. Stiglitz, Wirtschaftsnobelpreisträger von der New Yorker Columbia University, im Blick auf Griechenland. Die Flüchtlingskrise nennt er vor allem ein "moralisches Dilemma".
Stand:
Professor Stiglitz, Europa spricht fast nur über Flüchtlinge, kaum ein Wort über Griechenland. Ist das Problem gelöst?
Nein, das Problem wurde nur in die Zukunft verschoben. Warten wir ab, was aus der Parlamentswahl folgt, ob sich nun eine Konstellation ergibt, die das alte System der Oligarchen aufbrechen kann. Die Troika war dabei bisher wenig hilfreich. Die hat sich nicht auf die Oligarchen konzentriert, sondern auf Dinge wie Regulierung des Brot-Marktes oder Definitionen von Frischmilch, alles interessante Dinge, aber keine Angelegenheiten, die die Struktur des Landes fundamental ändern werden.
Sie behaupten gern, Deutschland sei für das Chaos dort verantwortlich.
Ja. Ich weiß genug aus dem Innenleben der Troika, um sagen zu können, dass Deutschland großen Einfluss auf diese Entwicklung genommen hat.
Tatsache ist aber doch: Griechenland ist für den Moment wieder flüssig und …
... wenn Sie es so nennen wollen. Zahlungsfähig aber sicher nicht. Der IWF hat mehr als deutlich gemacht, dass Griechenland seine Schulden nicht bedienen kann, dass das Land eine Umschuldung braucht. Das ist eine Tatsache, unabhängig davon, wie man das nennt: Schuldenschnitt, Schuldenstreckung oder sonst wie. Das ist alles nur Semantik.
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble legen Wert auf diese feinen sprachlichen Unterschiede.
Das kann ich gut verstehen. Politik muss harte Sachverhalte manchmal weich verpacken. Und ich bin gern behilflich bei der Formulierungssuche. Aber als Ökonom bin ich an der Substanz interessiert. Und im Falle Griechenlands ist die Faktenlage klar: Das Geld kommt nicht zurück. Die Frage ist nur, wann ihr Deutsche das erkennt.
Dabei sind konkrete Reformen fest vereinbart, das Land bleibt im Euro, Kapitalverkehrskontrollen werden zurückgenommen. Ist das etwa kein Fortschritt verglichen mit der Lage im ersten Halbjahr?
Für den Moment ja. Aber die Frage ist doch: Wie hoch ist die Chance, dass dieses Land in drei Jahren aus diesen Programmen aussteigen kann, dass die Gläubiger nicht wieder derart unerfreuliche Verhandlungen führen müssen. Sollten die Beschlüsse nicht überarbeitet werden, wird die Rezession in Griechenland sogar noch härter.
An welchen Punkten müsste aus Ihrer Sicht nachverhandelt werden?
Das Ziel, dass Athen im Jahr 2018 einen Haushaltsprimärüberschuss von 3,5 Prozent erreicht, muss reduziert werden auf nicht mehr als ein Prozent – kombiniert mit einem Umschuldungsplan, der nicht wie ein Strick um den Hals der Regierung hängt. Die Austeritätspolitik muss heruntergefahren werden. Was Griechenland tötet, ist nicht nur die Zurückhaltung der öffentlichen Hand, sondern auch die des Privatsektors. Wenn der Bankensektor derart zertrümmert ist wie in Griechenland, kann man wenig für die kleinen und mittelständischen Unternehmen tun. Und Griechenland ist ja ein Land der kleinen und mittleren Unternehmen. Man muss Wege finden, die Finanzierung dieser Firmen wieder zu gewährleisten.
Deutschland hat viel Erfahrung bei der Mittelstandsfinanzierung und Gründungsförderung.
Genau dieses Wissen, zum Beispiel die Erfahrungen der staatlichen Förderbank KfW, braucht das Land. Deutschland könnte unmittelbare Hilfe leisten, indem es den Griechen die Finanztechnologien bereitstellt, mit der man Kleinkredite vergibt, die auch tatsächlich zurückgezahlt werden können.
"Wenn sich nichts ändert, ist der Patient in drei Jahren tot"
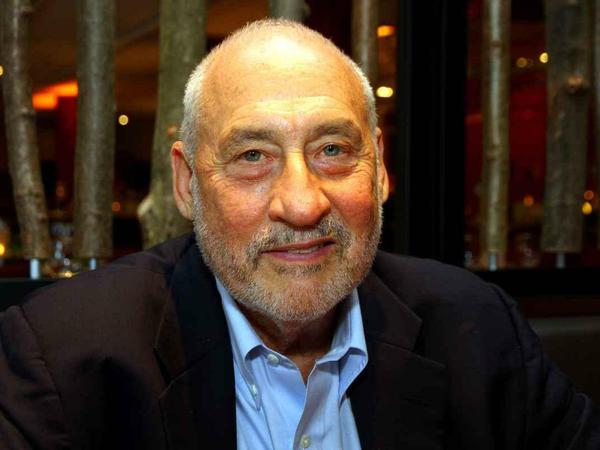
© Thilo Rückeis
Ihre Kritik dreht sich um die Austeritätspolitik Deutschlands, also das Bemühen um einen Abbau der Schulden. Ganz grundsätzlich: Was ist daran so falsch?
Es ist eine sehr gefährliche Politik. Die Finanzierung der kleinen und mittleren Betriebe funktioniert in allen europäischen Südländern nicht – anders als bei den Großkonzernen. Wenn das drei Jahre so weitergeht, ist der Patient tot. Europa muss die Bankenunion zügig vorantreiben. Das heißt nicht, dass Standortpolitik in jedem EU-Land gleich sein muss. Schauen Sie sich die USA an. Dort teilen sich 50 Bundesstaaten eine Währung. Es gibt riesige Unterschiede zwischen North Dakota und Kalifornien. Der Schlüssel liegt in der starken Rolle der US-Administration: Wenn Kalifornien ein Problem mit der Arbeitslosigkeit bekommt, kommt Hilfe aus Washington. In Europa gibt es bereits viel solidarischen Finanzausgleich, doch es sollte auch hier einen Fonds geben, um ein Land, dessen Arbeitslosigkeit steigt, zu stabilisieren.
Wie erklären Sie meinen Kindern, dass ihre Generation in 20 oder 40 Jahren weniger politischen Handlungsspielraum haben dürfte als heute, weil ein größerer Teil ihrer Steuern zur Schuldentilgung ausgegeben werden muss?
Zum einen glaube ich: Die Schulden kosten sie nichts. Weil sich Geld zu leihen, sagen wir über einen Euro-Bond, der Griechenland außen vor lässt, extrem günstig sein würde. Die meisten Länder sind ja finanziell stabil. Natürlich kann man sich nicht unbegrenzt verschulden. Es müsste Beschränkungen geben. Aber wenn man das richtig organisiert, läge das Ausfallrisiko bei null. Und der Ertrag aus höherem Wachstum in Europa würde auf der Haben-Seite stehen.
Natürlich sind Kredite derzeit billig. Und, anders als die für Großkonzerne, man kann viel damit bewegen. Trotzdem vererben Europas politische Akteure von heute Verschuldungskosten an die nächste Generation.
So darf man das nicht sehen. Man muss das Thema ganzheitlich betrachten: Wenn ein Staat ein Unternehmen wäre, würde man nicht allein auf den Schuldenstand schauen, sondern auf die Bilanz. Man würde den Verbindlichkeiten den Aktivposten, also dem Vermögen auf der Habenseite, gegenüberstellen. Bei einem Staat ist es natürlich nicht so leicht zu sagen, was genau die Vermögenswerte sind. Wenn Sie mich fragen, ob wir Geld leihen sollten, um einen neuen Krieg im Irak beginnen, würde ich sagen, dass wir das mit einer Menge Probleme schaffen, aber dafür nichts auf die Haben-Seite bekommen. Das wäre, unsere Kinder zu zwingen, einen Krieg zu bezahlen.
Kein Widerspruch.
Aber wenn wir in Forschung, Infrastruktur und Bildung investieren, wenn man das vernünftig anstellt, hat man den Wert der Bildung, Wert neuer Technologien und Infrastruktur auf der Haben-Seite, alles Dinge, die sehr hohe Erträge bringen. Eine andere Kategorie an Gütern ist das Humankapital. Dessen Wert kann man nicht so leicht erfassen. Aber wir spüren es sofort, wenn es fehlt – wie in Spanien und Portugal, wo die jungen Leute wegen der Krise massenhaft ihr Land gen Deutschland, England oder Australien verlassen haben. Das ist verheerend für ihre Heimatländer. Was sagt ein großes Unternehmen, wenn Sie den Chef fragen, was sein größter Wert ist?
Er wird sagen: Unsere Leute.
Und damit hat er recht. Und er meint vor allem die gelernten Arbeitskräfte, die schnell abgeworben werden können.
Lassen Sie auch uns über Flüchtlinge sprechen. Angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels sprechen sich deutsche Industrievertreter für eine eher großzügige Aufnahme Asylsuchender aus. Wie bewerten Sie das?
Volkswirtschaftlich betrachtet ist das sinnvoll: Wenn man in diese Menschen investiert und sie in die Wirtschaft integriert, wird man einen signifikanten positiven Nutzen daraus ziehen, speziell in einer alternden Gesellschaft und bei drohendem Arbeitskräftemangel. Japan, das ein noch größeres demografisches Problem hat, geht einen anderen Weg, um dasselbe Ziel zu erreichen: Dort zielen jüngste Strukturreformen darauf ab, Frauen stärker in Arbeit zu bringen.
"Donald Trumps Pläne verstoßen gegen die Verfassung"
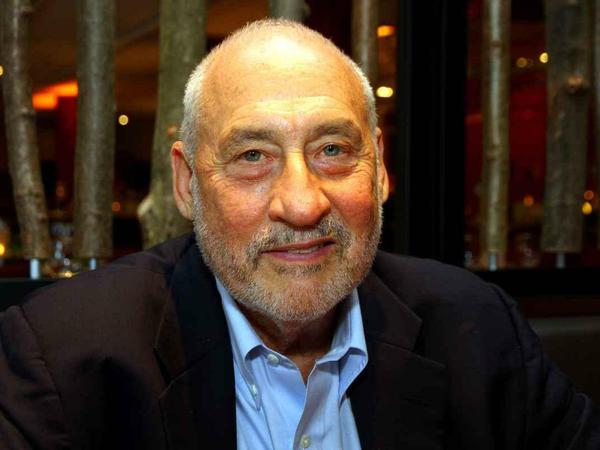
© Thilo Rückeis
Auch das versucht man hierzulande. Wie helfen Flüchtlinge der Wirtschaft noch?
Deutschland hat wegen des Umgangs mit der Flüchtlingskrise weltweit einen gewaltigen Schub bei der Soft Power erhalten – nachdem Ihr Land wegen der Griechenpolitik zuvor viele Punkte verloren hatte. Die Flüchtlingskrise ist in erster Linie ein moralisches Thema. Hier haben die USA zum Beispiel in den letzten Jahren versagt. Wenn sie sich schon nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen, sollten sie wenigstens einen signifikanten Teil der monetären Kosten tragen.
Lassen wir humanitäre Aspekte für den Moment beiseite: Braucht ein Land wie Deutschland eher mehr ungelernte Arbeitskräfte für all die nötigen einfachen Tätigkeiten oder wirklich mehr Akademiker?
Im Falle Deutschlands fällt auf, dass die am Einkommen gemessenen unteren 30 Prozent der einheimischen Bevölkerung sich schwer damit tun, in den Arbeitsmarkt zu fügen. Man müsste sich Sorgen machen, dass ein zu großer Anstieg des Angebots ungelernter Arbeitskräfte die soziale Ungleichheit verstärkt. Deutschlands Wachstumsstrategie konzentriert sich schließlich auf Hochtechnologien.
Bei der Gelegenheit: Was halten Sie vom Vorschlag des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, die Grenze zu Mexiko zu verstärken und Mexikaner auszuweisen?
Das ist widerwärtig in vielerlei Hinsicht. Er geht sogar so weit, dass er in den USA geborene Kinder von Mexikanern abschieben will…
…was wohl gegen die Verfassung der USA verstoßen würde.
Richtig. Diese Menschen haben Geburtsrechte jedes Amerikaners. Sie dürfen Präsident werden. Würden Trumps Pläne umgesetzt, würde das einen enorm großen wirtschaftlichen Schaden verursachen.
In Ihrem bald auf Deutsch erschienenes Buch „Die innovative Gesellschaft“ geben Sie Ratschläge, wie man eine lernende Wirtschaft und eine lernende Gesellschaft aufbaut.
Im Kern steht eine lange bekannte, aber kaum beachtete Erkenntnis. Dass sich die Lebensqualität unserer Gesellschaften bis vor etwa 200 Jahren über Tausende Jahre quasi kaum verbessert hat. Die großen Fortschritte, die im Zuge der Industrialisierung gemacht worden sind, basieren allein auf dem Lernen. Ökonomen stellten sich alle möglichen Fragen. Wie maximiert man Kapital, wie reduziert man Störungen des Arbeitsmarktes? Aber nicht die Kernfrage: Wie maximiert man das Lernen?
Angeblich leben wir doch in einer Wissensgesellschaft.
Die Antworten auf die klassischen Fragen der Ökonomie, etwa Kapitalmaximierung, führen aber oft zu politischen Entscheidungen, die sich gegen das Lernen richten. Indem wir uns auf die falsche Frage konzentriert haben, haben wir unseren Lebensstandard gesenkt. Das heißt, wir sollten politische Entscheidungen, dahin gehend abklopfen, inwiefern sie das Lernen fördern oder behindern. Würde Politik erkennen, wie ökonomisch schädlich es ist, Humankapital zu verschwenden, würde sie auch mehr gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa tun.
Also geht es Ihnen um mehr Geld für Bildungssystem?
Nein. Das Lernen in der Schule ist tatsächlich nur ein kleiner Bruchteil des gesellschaftlichen Lernprozesses. Andere Aspekte des Lernens haben wir eben schon umrissen: lernen, wie man KMUs fördert, Kredite vergibt oder gut regiert zum Beispiel. Die Politik sollte nicht nur auf das Bildungssystem konzentrieren.
In Ihrem Buch setzen Sie die Frage, wie Gesellschaften lernen, in den Kontext des Freihandels. Wo ist da der Zusammenhang?
Es geht um das erfolgreiche Prinzip Learning by Doing in Volkswirtschaften. Man kann nicht allein aus einem Fachbuch lernen, wie man Stahl produziert. Man braucht dafür eine Stahlhütte. Als Südkorea zum Beispiel vor 45 Jahren seinen großen Entwicklungsplan auflegte, sagten IWF und Weltbank: Euer Wettbewerbsvorteil liegt im Reisanbau. Haltet daran fest – und baut Reis an!
"Echten Freihandel gibt es nicht. Nirgends."
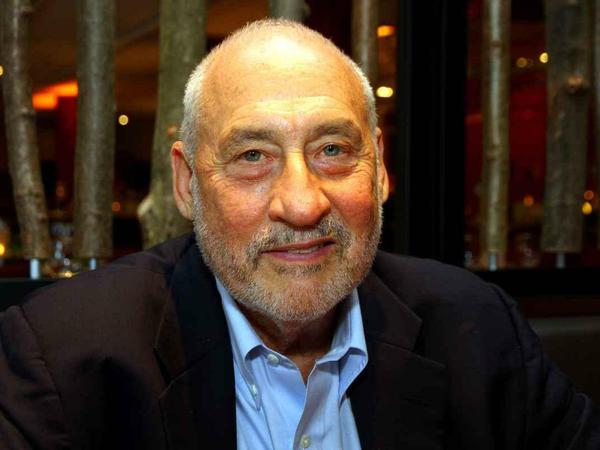
© Thilo Rückeis
Das hat Korea offenbar ignoriert.
Sie sagten: Danke. Aber, nein Danke! Wir wollen eine Industriemacht werden. Und das werden wir, indem wir beginnen, uns zu industrialisieren. Also bauten sie sich eine Stahlhütte. Und binnen 20 Jahren waren sie effizientere Stahlproduzenten als die Vereinigten Staaten.
Was hat das mit Freihandel zu tun?
Jede Menge. Südkorea wäre nie so weit gekommen, wenn das Land seinen Markt nicht geschützt hätte. Es geht nicht nur darum, junge Industriezweige zu schützen, sondern auch junge Volkswirtschaften. Erst dann kann sich dort etwas entwickeln: Wer eine Stahlhütte hat, braucht eine Uni für Ingenieure. Dort kommt es zu Überlaufeffekten: Studenten befassen sich auch mit neuen oder anderen Technologien. So lernen aufstrebende Volkswirtschaften intuitiv, Schritt für Schritt. Korea ging es nicht darum, Stahl zu produzieren, sondern Autos und Computerchips. Das Land wollte Wohlstand.
Für Freihandels- und Globalisierungskritiker gelten Sie als wichtige Stimme in der Debatte um geplante Abkommen wie TTIP. Sind Sie generell gegen Freihandel?
Echten Freihandel gibt es nicht. Nirgends. Es geht immer nur um den Abbau von Handelsregeln für Unternehmen. Subventionen aber, etwa in der Landwirtschaft, bleiben bestehen. Auch die Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums, die vereinbart werden, sind eigentlich eine Einschränkung des freien Handels. Wenn es bei TTIP wirklich um freien Handel ginge, bräuchte für den Vertrag nur drei Seiten Papier. Ich bin nicht generell gegen freien Handel. Aber in gewissen Entwicklungsstadien muss man einer Volkswirtschaft genug Spielraum für Entwicklung lassen.
Was kann so falsch daran sein, sich auf beiden Seiten des Atlantiks auf einen Standard für Autoteile zu einigen?
Wenn es darum ginge, dass sich Parlamente aller beteiligten Länder auf Standards einigen, wäre ich dafür. Aber es sollte demokratisch zugehen. Zugleich muss man nicht alles harmonisieren. Die Deutschen lehnen Gen-Food ab und wünschen sich eine Kennzeichnung entsprechender Produkte. Die Amerikaner lehnen Kennzeichnung ab. Eine Harmonisierung könnte bedeuten, dass jemand, der einen entsprechenden Hinweis auf die Packung klebt, vor einem Schiedsgericht verklagt werden könnte, weil er ja damit Leute vom Kauf abhalten könnte. Oder nehmen Sie Asbest: Als vor Jahrzehnten festgestellt wurde, dass das giftig ist, mussten die Hersteller Entschädigung zahlen. Nach TTIP-Logik müsste die Regierung dem Hersteller eine Entschädigung dafür zahlen, dass er nicht weiter Menschen vergiften darf.
Professor Stiglitz, Ihre Kapitalismuskritik hat schon Generationen inspiriert. Und doch hat man das Gefühl, dass die Welt sich in die andere Richtung bewegt: Frustriert Sie das?
Gar nicht. Ich sehe das anders. Zumindest zu Hause in den Vereinigten Staaten unterstützen mittlerweile alle Kandidaten der Demokraten das, was ich als fortschrittliche Agenda bezeichnen würde. Man sieht es bei uns überall im Land: Bürgerrechtsbewegungen, die sich für Mindestlohnregelungen stark machen – und Erfolg haben. So etwas gab es früher nicht. Das heißt nicht, dass wir gewinnen werden, aber man könnte sagen: Die Entwicklung ist vielversprechend.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch über Apple, Google und Amazon. Die sind an der Börse milliardenschwer, gemessen daran aber relativ kleine Arbeitgeber.
Meine Kritik ist nicht, dass sie zu wenige Jobs schaffen. Das ist einfach Ausdruck technologischer Evolution. Ich kritisiere aber, dass sie fast keine Steuern zahlen, um damit andere Jobs und das Lernen zu finanzieren.
Sollte man diese Firmen boykottieren?
Man könnte und sollte Steuervermeider boykottieren. Das Problem ist, es gibt so viele davon, dass man am Ende nicht einmal ein Telefon haben würde. Ich persönlich versuche zum Beispiel Amazon zu vermeiden – wenn es das Buch bei mir im örtlichen Buchladen gibt.
Joseph E. Stiglitz, geboren 1943 in Gary im US-Bundesstaat Indiana, war einst Chef der Wirtschaftsberater von Präsident Bill Clinton. Von 1997 bis 2000 arbeitete er als Chefökonom für die Weltbank. Der Wirtschaftswissenschaftler erhielt für seine Arbeiten über das Verhältnis von Information und Märkten 2001 zusammen mit George A. Akerlof und Michael Spence den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Stiglitz lehrte bereits an den Universitäten Stanford, Oxford und Princeton. Derzeit ist er Professor an der Columbia in New York City und unterrichtet ebenso an den französischen Elitehochschulen École polytechnique und Sciences Po Paris.
Am 9. Oktober erscheint sein mit Bruce C. Greenwald verfasstes Buch „Die innovative Gesellschaft - Wie Fortschritt gelingt und grenzenloser Freihandel die Wirtschaft bremst“ in deutscher Sprache im Econ Verlag (608 Seiten, 28 Euro.)
- Angela Merkel
- Donald Trump
- Griechenland
- Hochschulen
- Kalifornien
- Lars Klingbeil
- Schule
- Troika
- TTIP
- Wolfgang Schäuble
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: