
Angeblich haben Kinder zu wenig Reife oder Demokratieverständnis, um an die Urne zu gehen. Aber das ist kein geeignetes Kriterium: Es würde auch viele Erwachsene ausschließen.

Angeblich haben Kinder zu wenig Reife oder Demokratieverständnis, um an die Urne zu gehen. Aber das ist kein geeignetes Kriterium: Es würde auch viele Erwachsene ausschließen.

Zahlreiche neue Forschungsprojekte konkurrieren darum, von Bund und Ländern als Exzellenzcluster gefördert zu werden.

Die liberale Gesellschaftsordnung steht unter Druck, ist nicht mehr der Sieger der Systeme. Müssen wir unser Verständnis von Freiheit hinterfragen? Eine Analyse.

Putin verachtet den Liberalismus, doch was sind eigentlich seine Pläne für Russland und die Welt? Antworten aus einem Berliner Forschungsverbund.

Die Abgrenzungsrhetorik gegenüber dem Westen hat sich in China unter Xi Jinping verstärkt. Das Regime hält den Staat mit aller Macht zusammen.

Weltweit sind Rechtspopulisten eine dominante Kraft. Das liberal-demokratische Ordnungsmodell wird von außen und von innen heftig attackiert.

Europäische Ideen sind im 20. Jahrhundert oft über Umwege nach Asien gelangt. Dort haben sie große Wirkungen entfaltet – manchmal mit verheerenden Folgen

Am Exzellenzcluster der Freien Universität, „Contestations of the Liberal Script“, werden die weltweiten Bedrohungen der Demokratie erforscht.

In ihrem Werk „Gekränkte Freiheit“ gehen die Soziolog:innen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey dem neuen Phänomen des libertären Autoritarismus auf den Grund.

Die Auflösung der Sowjetunion prägt die russische Gesellschaft ebenso wie der Wunsch, eine Weltmacht zu werden. Gibt es Parallelen zur deutschen „Schmach von Versailles“? Eine Analyse.

Gottfried Paasche beschreibt seine Mutter und zwei Tanten, die Berliner Hammerstein-Töchter, als in der Nazizeit unangepasste Adelstöchter im Widerstand gegen Hitler.

Die Berliner Kognitionsforscherin Monika Schwarz-Friesel zeigt, wie Judenhass seit Jahrhunderten das Denken und Fühlen zahlreicher Gesellschaften prägt.

Bei einer Veranstaltung der Max-Weber-Stiftung können die Besucher mit Historikern über die Probleme der europäischen Integration diskutieren.

Das Luxemburger Abkommen markiert den Beginn der deutsch-israelischen Beziehungen. Zum ersten Mal wurde hier über Reparationen für die Opfer von Völkermorden diskutiert.

Heutige Rechtsextremisten gelten als euroskeptisch. In der Nachkriegszeit aber hatten sie einen supranationalen europäischen Staat im Sinn.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vergleicht Bildungssysteme der Länder. Dank Digitalisierungs-Fortschritten steigt Berlin im Ranking auf Platz 11.

Die großen Krisen gehen auf unser Wirtschaften zurück, sagt Nancy Fraser. Der Mangel an Alternativen führe zu „morbiden Symptomen“ wie dem Rechtspopulismus.

Eine neue Ausstellung im DHM vermittelt die Geschichte der Staatsbürgerschaft. Diese führte immer schon Menschen zusammen - und trennte sie zugleich.
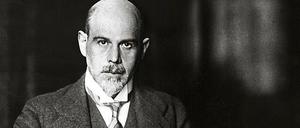
Der Mord an Walther Rathenau vor 100 Jahren gebar die wehrhafte Demokratie. Heute wie damals ist der Rechtsextremismus ihre größte Bedrohung.

Digitale Medien können entfremdend und erschöpfend wirken, meinen Experten. Warum der direkte Kontakt nicht zu ersetzen ist. Eine Analyse.

Forscher aus der Ukraine und Deutschland diskutieren den Wandel der ukrainischen Gesellschaft durch den Krieg, Russlands Ziele und Versäumnisse der Wissenschaft.

Unterdrückte Erinnerung an die Shoa: Warum der ukrainische Präsident trotz jüdischer Herkunft als „Nazi“ geschmäht wird – und das auf offene Ohren stößt.

Kaum zu besiegen: Die Ukrainer wehren sich auch mit Guerilla-Taktik gegen Russland. Das Vorgehen hat erfolgreiche historische Vorbilder.

Vor 150 Jahren wurde die Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums eröffnet. Liberale jüdische Ideen gelangten von hier aus in die Welt.
öffnet in neuem Tab oder Fenster