
In Deutschland arbeiten besonders wenige Frauen in den mathematischen Fächern. Es fehlt an Vorbildern und manchmal auch am Willen, etwas zu ändern – doch die FU steuert gegen.

In Deutschland arbeiten besonders wenige Frauen in den mathematischen Fächern. Es fehlt an Vorbildern und manchmal auch am Willen, etwas zu ändern – doch die FU steuert gegen.
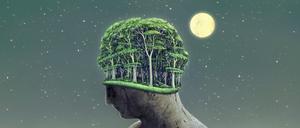
Auch in der Psychologie wird der Klimawandel intensiv diskutiert. Denn Naturkatastrophen traumatisieren und die Jugend sorgt sich über ihre Lebensgrundlagen in der Zukunft.

Die „Polarstern“ startete erstmals 1982 in die Arktis, bis heute sammelt sie am Nordpol Daten zu Wetter, Eis und Klima. Im Deutschen Technikmuseum können Kinder jetzt entdecken, wie Forschende dabei vorgehen.

Vorträge gibt es viele in Berlin, aber im Zeiss-Großplanetarium werden sie zum besonderen Erlebnis. Vor allem, wenn es um das All und Satelliten geht.

„Dare to know“ – also soviel wie „Trau dich, zu wissen“ lautet das Motto des diesjährigen Wissenschaftsfestivals in Berlin. Zum ersten Mal ist das Kulturquartier „Holzmarkt 25“ dabei.

Im Heimathafen Neukölln brachten Forschende aus ganz Deutschland nützliches Gesundheitswissen auf die Bühne: Von Schmerzen beim Sex über Algen als Superfood bis hin zum Werbemythos „probiotisch“.

Pflegeroboter können Patienten aufheitern und sie an Medikation erinnern. Welche Grenzen es aber auch bei der Interaktion mit Erkrankten geben sollte, wollen Potsdamer Ethik-Forscher jetzt mit Bürgern diskutieren.

Schwarze Löcher, Quantencomputer und Spiegeluniversen: Im letzten Teil unserer Serie widmen wir uns der Wissenschaft, die uns fasziniert wie Science Fiction, aber meistens noch Grundlagenforschung ist.

Ob Heilung für das Nervensystem, der Kampf gegen Viren oder neue Therapien. Die Spitzenmedizin in der Hauptstadt hat viele Facetten, wie Folge 9 unserer Serie zeigt.

Welche Gefühle erzeugen Bilder von überschwemmten Städten in uns? Wie könnte Berlin 2045 aussehen? Eine Ausstellung zeigt, wie sich Kommunikation auf das Handeln in der Klimakrise auswirkt.

Welche Kräfte bestimmen über Macht und Reichtum? Was beeinflusst Wahlentscheidungen? Unser Gesellschaftssystem beschäftigt die Forschenden in Teil 8 unserer Serie.

Die Gene steuern unser Leben mithilfe einer ausgeklügelten Maschinerie in der Zelle. Das zu verstehen ist wichtig für vieles – für die Therapie von Krankheiten etwa oder für die biologische Vielfalt, wie diese Forschenden zeigen. Teil 7 unserer Serie.

Was eint Gesellschaften, was spaltet sie? Diese Frage treibt diese Forschende um, denen es um politische, soziale oder technische Herausforderungen geht. Teil 6 unserer Serie.

Technik verbessert unser Leben, fordert unsere Gewohnheiten aber auch immer wieder heraus. Ganz aktuell zeigt sich dieses Dilemma bei der Künstlichen Intelligenz. Teil 5 unserer Serie.

Wir sind fasziniert vom Erbe der Menschheit. Was wir aus unserer Geschichte lernen können – in Kunst, Literatur oder auch Wirtschaft, beschäftigt diese Spitzenforschenden. Teil 4 unserer Serie.

Wie Lebewesen funktionieren und wechselwirken, gehört zu den spannendsten Fragen auf unserem Planeten. Diese zehn Forschenden gehen der Biologie in und um uns auf den Grund. Teil 3 unserer Serie.

Wissenschaftler:innen präsentieren ihre Projekte – das Publikum kürt den Sieger. Der 6. „Antiquity Slam“ fand in diesem Jahr vor besonderer Kulisse statt. Der Gewinner kommt aus Frankfurt.

Auch wer nicht studiert, kann in der Volkswagen-Universitätsbibliothek kostenlos Medien ausleihen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Das lohnt sich – auch wegen des wachsenden digitalen Angebots.

Beim Humboldt-Residency-Programm arbeiten Expert:innen aus aller Welt zusammen am Thema Nachhaltigkeit. Und liefern Ideen und Strategien für einen Kulturwandel.

„Mechanik ist für viele Studierende ein Angstfach“, sagt Professorin Christina Völlmecke. Ein neues Lernspiel soll das ändern – und auch mehr Frauen für technische Themen begeistern.

Wie geht nachhaltige Ernährung, die alle miteinbezieht? Die Berliner Unis haben den Wandel untersucht – zum Beispiel im Labor, in Kenia sowie Berlin und Brandenburg.

Anton Tartz hat eine Lese-Rechtschreibstörung – und studiert an der Freien Universität Geschichte. Möglich machen das digitale Hilfsmittel und die Unterstützung von Dozenten.

Für die neue Ausstellung im Museum für Kommunikation haben Forschende drei Jahre Coronapandemie ausgewertet. Eine Zeit, die heute schon fern scheint, aber aus der sich für die Zukunft lernen lässt.

Schon früh prägten Frauen die religionsbezogene Arbeit in Berlin. Doch ihrem Wirken waren in der Kirche enge Grenzen gesetzt. Eine Ausstellung an der Humboldt-Uni erinnert an die Theologinnen.
öffnet in neuem Tab oder Fenster