
Über den Ur-Moment der Demokratie und die Kostbarkeit des Wahlrechts, das in fast 40 Prozent der Länder weltweit nicht existiert.

© Nassim Rad/Tagesspiegel
Die Tagesspiegel-Kolumne

Über den Ur-Moment der Demokratie und die Kostbarkeit des Wahlrechts, das in fast 40 Prozent der Länder weltweit nicht existiert.

Auf der Berlinale ist Claude Lanzmanns „Shoah“ wiederzusehen. Neun Stunden dauert der Dokumentarfilm, der vor 40 Jahren eine Zeitenwende markierte. Warum die Wahrheit einen langen Atem braucht.

Menschenrechte? Redefreiheit? Ideal und Wirklichkeit liegen oft weit auseinander. Was können Kunst und Kultur gegen deren zunehmende Gefährdung ausrichten?

Die Allgmeine Erklärung der Menschenrechte wird in diesem Jahr 77. Von ihrer Realisierung ist die Welt weit entfernt – man denke nur an Iran oder Afghanistan.

Unter der Russifizierung Georgiens leiden auch die Kulturschaffenden. Bei den Protesten nach der Wahl spielen sie eine wichtige Rolle. Schließlich hat die Vielstimmigkeit hier eine uralte Tradition.

Vier Millionen Dollar Strafe wegen Diskriminierung jüdischer Flugpassagiere: Die Forderung des US-Verkehrsministeriums ändert nichts daran, dass der Judenhass auch in den USA immer stärker wird.

Ob in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine, in Hongkong oder den republikanisch regierten US-Staaten: Wer die Macht hat, kontrolliert auch die Bildung.

Wozu sind Jahrestage gut, private und offizielle? Bedeuten sie mehr als ein förmliches Ritual? Ja, denn sie stoppen den Zeitfluss, katapultieren Vergangenes mitten ins Hier und Heute.

Der Dokumentarfilm „Russians at War“ löste beim Filmfest Venedig heftige Debatten aus. Regisseurin Anastasia Trofimova wirft die Frage auf: Darf man Mitgefühl für Täter empfinden?

Seit mehr als 550 Tagen ist die belarussische Musikerin und Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Haft. Die Familie hat keinen Kontakt mehr zu ihr, ihre Schwester fürchtet das Schlimmste.

Ob die Demokratin Kamala Harris erste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, entscheidet sich nicht allein am Frauenbild der Kandidaten. Aber es spielt im Wahlkampf eine größere Rolle denn je.

Nach der EM ist vor den Olympischen Spielen: Alles Fairplay und ohne Diskriminierung, wenn große Turniere in demokratischen Ländern stattfinden? Ein Blick zurück nach vorn.

Ein Interviewband versammelt Assoziationen zu Deutschland und Israel von Menschen, die hier oder dort leben. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat ihn herausgegeben.
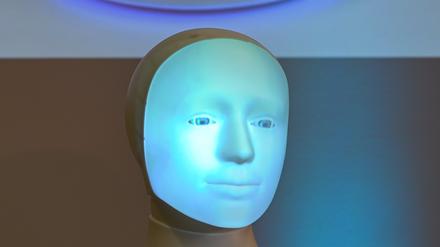
Der Chatbot sieht seine Entwickler in der Verantwortung, ihn ethisch zu programmieren. Nachdem die EU sich auf erste KI-Regeln geeinigt hat, gibt es viele offene Fragen.

Frauen als Regisseurinnen? In der Filmbranche geht es nur zäh voran mit der Quote. Ein paar Zahlen im Vorfeld der Filmpreis-Gala und ein Vorausblick auf das Filmfest in Cannes.

Mit den Militärschlägen gegen Israel gerät die Entrechtung der Frauen im Iran in Vergessenheit. Zwei aktuelle Dokus thematisieren das Phänomen der „Zeitehe“, religiös kaschierter Prostitution, bei der die Frauen männlicher Willkür machtlos ausgesetzt sind.

Die weltweiten Menschenrechtsverletzungen sind schier endlos. Sich um den Antisemitismus vor der Haustür zu kümmern, ist schon mal ein Weg.

Trotz Anspielungen auf Putins Unterdrückungsregime: Michael Lockshins Adaption von Bulgakows „Meister und Margarita“ ist in Russland beliebt – und nach wie vor nicht verboten.

Im Kulturkampf um Leitlinien und Boykotte verhärten sich die Fronten. Wie wär’s da mit einem Blick auf den „Beutelsbacher Konsens“ und sein Kontroversitätsgebot?

Proteste wie gegen Anna Netrebko? Der türkische Starpianist und Brückenbauer Fazil Say bezichtigt Israel des Völkermords. In Deutschland stört sich keiner daran.

Angesichts der Vielzahl der Kriege und Krisen fühlen viele sich überfordert. Über das Recht auf Pausen und das Privileg, davon Gebrauch machen zu können.

Das Unrecht bezeugen: Das Human Rights Film Festival Berlin zeigt Filme aus der Ukraine. Und eine Doku der iranischen Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi.

Embedded Journalismus: Was begreifen wir über Täter, wenn wir ihnen mit der Kamera folgen? Überlegungen angesichts der Venedig-Premiere des Taliban-Films „Hollywoodgate“.

Was hilft mehr gegen das Unrecht in der Welt, lautstarkes Getrommel oder stille Diplomate? Vom Zusammenhang zwischen Krach, Macht und Protest.

Über 400 Menschen wurden in diesem Jahr im Iran bereits hingerichtet, auch die Schikanen gegen Filmemacher gehen weiter. Ali Ahmadzadeh darf nicht ausreisen – und ein Berliner Open-Air-Festival zeigt Filme zur Todesstrafe im Iran. Hinsehen!

Wie Geopolitik, Religion und bigotte Moral bei den Blockbustern der Saison die Zensur in Asien auf den Plan rufen – und wie „Barbie“ in China ankommt.

Verstärkt sie nun Diskriminierung und Ausgrenzung oder ist sie unverzichtbar bei Protest- und Demokratiebewegungen? Über Chancen und Gefahren der Gruppendynamik.

Til Schweiger, Till Lindemann - und wieder Machtmissbrauch an deutschen Bühnen. Jetzt soll ein Verhaltenskodex für die Kulturbranche erarbeitet werden. Bringt der was?

Zugehörigkeit oder Abschottung, Abgrenzung oder Ausgrenzung, darum geht es im Kern bei vielen Debatten. Besser wäre es, auf das Verbindende zu setzen.

Die polnische Theaterregisseurin Magda Szpecht zeigt in ihrer Lecture-Performance „Cyber Elf“ beim Berliner Theatertreffen, wie sie im Internet gegen russische Propaganda vorgeht.

Das „Nurejew“-Ballett ist abgesetzt und aus den Buchhandlungen verschwinden immer mehr Titel. Zu den Folgen der Gesetzesverschärfung gegen „Propaganda nicht-traditioneller Beziehungen“.

Wie die Schriftstellerin aus Simbabwe über die Versehrtheit und die Heilkraft der Sprache schreibt.

Bei der Oscar-Gala brach Michelle Yeoh eine Lanze gegen Altersdiskriminierung. Was die Geschichte der Oscar-Dankesreden über Frauenbilder und -rechte verrät.

Keine Masken, volle Kneipen, überall Menschenmengen: Ist das jetzt die neue alte Normalität? Ein Blick zurück auf den ersten Berliner Lockdown vor drei Jahren.

Sind Tolstoi und Tschaikowsky vom Angriffskrieg gegen die Ukraine infiziert? Warum es wichtig ist, die Debatte auch weiter zu führen.

Der UNHCR findet den Begriff „Geflüchtete“ banal. Aber er klingt weniger nach Opfer und Mitleid als „Flüchtlinge“. Worte machen Stimmung. Über eine immer wieder aufflackernde Diskussion.
öffnet in neuem Tab oder Fenster