
Auf die ARD-Israelkorrespondentin Sophie von der Tann prasselte einige Kritik ein. Dabei tut sie nur, was Wissenschaftler auch machen: Sie ordnet das Geschehen aus einer informierten Perspektive ein.


Auf die ARD-Israelkorrespondentin Sophie von der Tann prasselte einige Kritik ein. Dabei tut sie nur, was Wissenschaftler auch machen: Sie ordnet das Geschehen aus einer informierten Perspektive ein.

Syrer sollten ihr Land wieder aufbauen, also Deutschland verlassen. Das ist zu kurz gedacht! Studien zeigen: mit ihrer Arbeit im Ausland und neuem Wissen helfen die Geflüchteten der Heimat am besten.

Sinologie, Zentralasien- oder Islamwissenschaft – lohnt es sich noch, solche kleinen, spezialisierten Fächer zu studieren? Sie auf den direkten praktischen Nutzen zu reduzieren, wird ihnen nicht gerecht.
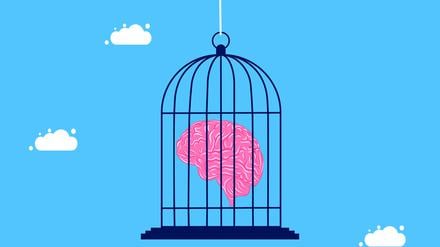
Während in den USA unter der Trump freie Forschung und Lehre demontiert werden, gelten sie hier noch als hohes Gut. Doch auch wir sollten wachsam sein für Sprechverbote und politische Eingriffe an den Unis.

Sind Unis unter Spardurck, rücken oft „Nischen-Fächer“ wie Regional- und Sprachstudien zu Asien und Afrika auf der Streichliste. Wir müssen sie schützen! Sie bilden Personal aus, das künftig gefragt sein wird.

Es winken traumhafte Bedingungen: Etwa Staaten aus der Golfregion bieten großzügige Förderungen oder eine hohe Vielfalt an den Unis. Forscher sollten bei manchen Angeboten aber vorsichtig sein.
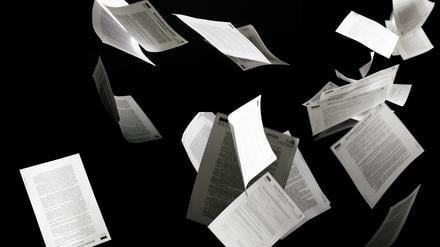
Rechenschaft für Kleinstbeträge, europaweite Ausschreibungen für eine einfache Übersetzung: Die Wissenschaft muss teils absurde Verwaltungsakte ableisten. Wird dies nun endlich besser?

Während des Kriegs fanden viele Syrer in Deutschland Zuflucht. Anstatt sie alle nur zur Rückkehr aufzufordern, sollten wir sie beim Wiederaufbau unterstützen. Denn auch von hier aus kann man helfen.

Nach Berlin kommen auch viele geflüchtete Forschende. Könnten wir die Präsenz so vieler kluger Köpfe nicht besser nutzen, dass Vertreter verfeindete Regionen hier miteinander reden?

Exzellente Unis und das Erasmus-Programm ziehen internationale Talente an. Doch seit der Nahostkrise schaden Ausladungen von Profs und die Fördergeldaffäre im Ministerium unserem Image. Die Wissenschaft muss offen bleiben!

Über Israel und Palästina kann aus unterschiedlicher Perspektive gesprochen werden. Die Universität bietet Raum für die kontroverse, aber respektvolle Debatte.

Wer forscht, publiziert und gelesen werden will, muss sich im Grunde für Englisch entscheiden. Die Wissenschaft sollte dennoch ihre Mehrsprachigkeit erhalten: Sie birgt die notwendige Differenzierung.

Die Ansprüche steigen, doch wird dem akademischen Nachwuchs weniger Zeit für seine Entwicklung zugestanden. Dieser Widerspruch verheißt nichts Gutes für den Forschungsstandort Deutschland.

Lehrpersonal muss besser über politische Konfliktherde Bescheid wissen. Gerade in einer „globalen Stadt“ wie Berlin sollte auch in der Schule Weltwissen vermittelt werden.

Universitäten sind Orte, an denen Menschen jeder Herkunft und jeden Glaubens gemeinsam an etwas Größerem arbeiten. Übergriffige Maßregelung würde diese Freiräume bedrohen.

Wegen des Nahostkonflikts schauen internationale Partner in der Wissenschaft mit zunehmender Befremdung auf uns. Denn anders als auch in Israel selber fehlen Freiräume für kontroverse Debatten.

Bis 2035 wollen die Wissenschaftsorganisationen die Klimaneutralität erreichen. Um die notwendigen Aufrüstungen der Institute auch zeitnah umzusetzen, braucht es die Unterstützung der Politik.

In vielen Ländern unterdrücken Autokraten Minderheiten und schränken Freiheiten ein. Und dennoch: Wo Spielräume weiter bestehen und Dialog möglich ist, sollte auch die Wissenschaft Kontakt halten.

Arbeitsschutz braucht es auch in der Wissenschaft, klar. Doch die Forderung nach strikter Zeiterfassung geht an der Praxis vorbei. Forschung ist kein Nine-to-Five-Job, sie braucht Flexbilität.

Im Streit um Karrierechancen in der Forschung verteufeln viele befristete Verträge. Doch gerade an Unis braucht es flexible Modelle, um für exzellenten Nachwuchs Übergangslösungen zu schaffen.

Große Projekte mit Forschenden mehrerer Disziplinen zu fördern, liegt im Trend. Das ist wichtig, doch auch die Einzelforschung muss weiter gefördert werden: Sie schafft die Grundlagen für Kooperation.

Quellen und Ergebnisse der Forschung öffentlich verfügbar zu machen, kann auch problematisch sein – etwa wenn es um sensible politische Kontexte geht.

Bürokratie bedroht zunehmend die Qualität von Forschung und Lehre. Eine Lösung wäre, den Bereich weniger kleinteilig zu gestalten und Verwaltungswissen unter Instituten zu teilen.

Graduiertenschulen, ein offenes Modell akademischer Nachwuchsausbildung, waren ein Erfolg. Jetzt gilt es, sie zu verstetigen – und stabile Bedingungen für Promovierende zu schaffen.
öffnet in neuem Tab oder Fenster