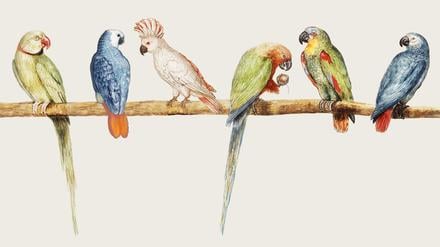
Sprachmodelle wie ChatGPT sorgen dafür, dass das menschliche Denken verkümmert, warnt Roberto Simanowski. Im Interview erklärt er, wie Künstliche Intelligenz ihre Nutzer manipuliert.
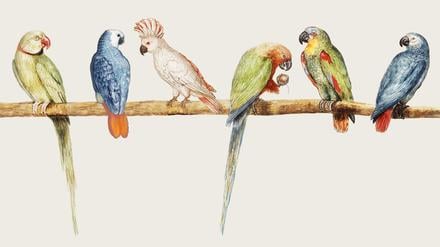
Sprachmodelle wie ChatGPT sorgen dafür, dass das menschliche Denken verkümmert, warnt Roberto Simanowski. Im Interview erklärt er, wie Künstliche Intelligenz ihre Nutzer manipuliert.

Exosoziologe Michael Schetsche erforscht, was die Begegnung mit Aliens für uns bedeuten würde. Er hofft, ein solches Aufeinandertreffen selbst nicht zu erleben

Der renommierte Übersetzer Olivier Mannoni hat Hitlers „Mein Kampf“ neu ins Französische übertragen. Sein Ziel ist es, die Menschen für die Parolen heutiger Rechtspopulisten zu sensibilisieren.

Ihr Studium kam ihr sinnlos vor, also ging Johanna Klug auf die Palliativstation. Was die Sterbenden dort bereuen, worüber sie lachen – und worauf es ankommt, wenn man für sie da sein will.

Auch eine Koalition folgt den Gesetzen einer Beziehung, sagt Paartherapeutin Ilka Hoffmann-Bisinger. Sie weiß, wie Scholz und Lindner die Ampel vielleicht hätten retten können – und wann es wirklich Zeit ist, zu gehen.

In der Branche ist Kassaei berühmt-berüchtigt. Warum Werbung sich nichts mehr traut und welche seiner Ratschläge die SPD in den Wind schlug. Ein Gespräch.

Klimaforscher machen immer genauere Vorhersagen. Trotzdem steuert die Menschheit nicht um. Der Literaturwissenschaftler Martin Puchner sagt: Das liegt auch an Büchern und Filmen.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ingrid Robeyns will private Vermögen auf zehn Millionen Euro begrenzen. Wie kommt sie auf diesen Betrag, und was würde das bringen?

Die Gesellschaft ist zu tolerant gegenüber Extremisten, meint Seyran Ateş. Sie setzt sich für einen liberalen Islam ein – und lebt gefährlich. Von Testosteron-Machos, TikTok-Predigern und den Zuständen in der U8.

Evangelikale Christen sind so etwas wie die spirituellen Begleiter des globalen Rechtsrucks, sagt die Religionswissenschaftlerin Dorothea Lüddeckens. Was treibt die Fundamentalisten an?

Die Witwe des Studentenführers Rudi Dutschke zieht eine Bilanz und benennt Gründe für Radikalisierungen. Zudem erklärt die Alt-68erin, warum sie den Gang in den Untergrund für falsch hält.

Anna von Boetticher ist Rekordhalterin in der Sportart Apnoetauchen – und schult Marinesoldaten. Was treibt die Geisteswissenschaftlerin an, ohne Sauerstoffflasche in bis zu 125 Meter Tiefe zu tauchen?

Viele Menschen mit Migrationshintergrund erlebten Deutschland als feindselig, sagt Stephan Anpalagan. Der Theologe und Autor über Pro-Palästina-Demos, ächzende Gemeinden und einen Konservatismus auf Sinnsuche.

Nach Corona fahren die Deutschen wieder mit Freuden in den Urlaub. Eine Philosophin wirbt für das Gegenteil: das Glück des Hierbleibens. Über Freiheit – und Grünkohl im Garten.

Sie ist Co-Chefin des Berliner Auktionshauses Villa Grisebach: Diandra Donecker. Welches Kunstwerk sie zuletzt zu Tränen rührte und was passiert, wenn der Bietende nicht bezahlen kann.

Acht Milliarden, Tendenz steigend: Der Philosophieprofessor Tim Henning erforscht, unter welchen Umständen es ethisch vertretbar ist, Kinder in die Welt zu setzen – oder weniger Fortpflanzung zu fordern.

Der Islam, die Medien, die Ausländer: Hass kennt viele Zielscheiben. Doch wie hält man am besten dagegen? Bildungswissenschaftler Klaus-Peter Hufer rät zu deutlichem Widerspruch – und einer Prise Humor.
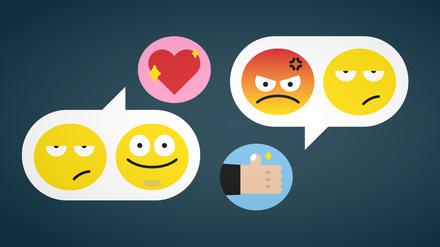
Lässt das Internet unsere Sprache verarmen? Nein, sagt Linguistin Christa Dürscheid, die das Schreiben in Text-Messengern erforscht. Aber zu viel Handykonsum schade aus anderen Gründen.

Fleißig, ruhig, integrationswillig – oder Zigarettenschmuggler: So sehen viele Deutsche ihre vietnamesischen Mitbürger. Doch diese Stereotype verdecken eine komplexe soziale Realität, sagt der Sozialforscher Kien Nghi Ha.

Hier Vernunft und Wahrheit, dort Pathologie und Verirrung? Wer Verschwörungstheoretiker stigmatisiere, mache es sich zu einfach, sagt die italienische Professorin Donatella Di Cesare.

Die Nahost-Expertin Muriel Asseburg über die Wiederaufnahme des Landes in die Arabische Liga, neue Giftgasarsenale Assads und Moskaus Interessen.

Politische und philosophische Weisheit lassen sich nicht nur aus der Aufklärung ableiten, argumentiert Pankaj Mishra. Der indisch-britische Autor über neoliberalen Schick und „die Religion des Weißseins“

1619 erreichte das erste Sklavenschiff Amerika. Nikole Hannah-Jones hat untersucht, wie die Folgen der Knechtschaft in die Gegenwart reichen – und bekam dafür den Pulitzer-Preis.

Tobias Ginsburg recherchierte unter Verschwörungsideologen und Rechten. Diese als lustige Irre darzustellen, sei gefährlich, sagt er. Denn anfällig sei auch die Mitte der Gesellschaft.
öffnet in neuem Tab oder Fenster