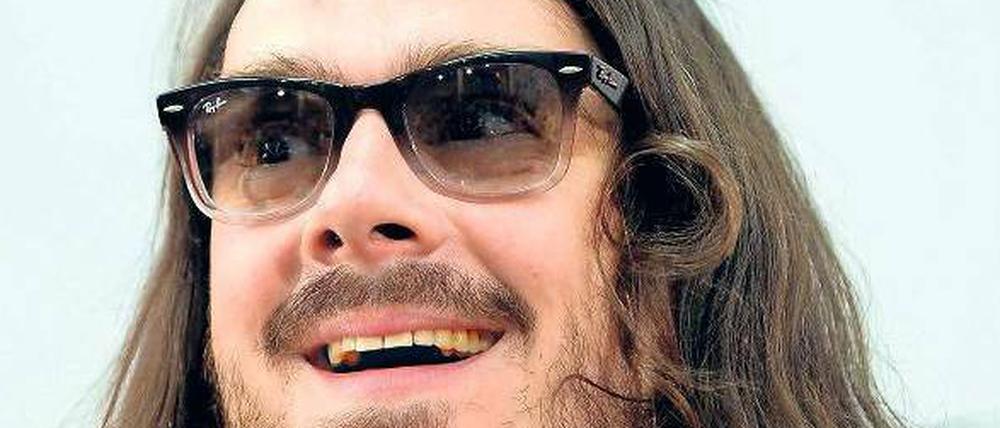
© picture alliance / dpa
Symposium an der Deutschen Oper: Gebt uns was zu denken, was zu fühlen!
Philosophen, Praktiker, Rebellen: An der Deutschen Oper suchen illustre Gäste nach der Zukunft des Musiktheaters. Auch Jonathan Meese schaut vorbei.
Stand:
Wir haben uns daran gewöhnt, in der Oper die immer gleichen Stücke zu sehen. Wir haben auch weitgehend unseren Frieden mit den gängigsten Regie-Lesarten gemacht. Bringen wir die Oper damit um ihre Zukunft? Der Deutsche Bühnenverein warnte unlängst vor einem vereinheitlichenden Inszenierungsstil. Gibt es auf der Bühne überhaupt noch Raum für Überraschungen in der Begegnung mit den Klassikern? Dieser Frage will die Regisseurin und Professorin Barbara Beyer an der Kunstuniversität Graz nachgehen. Ihr Forschungsprojekt trägt den abschreckenden Titel „Zwischen Hermeneutik und Performativität“. Mit dem einfacheren, aber dennoch schwer zu fassenden Untertitel „Oper anders denken“ stellt Beyer drei Versuchsinszenierungen von Mozarts Così (Rezension folgt) und ein Symposium mit illustren Gästen an der Deutschen Oper zur Diskussion.
Können wir uns unserem Repertoire auf unausgetretenen Pfaden nähern? Oder gilt mit Boris Groys, dass alle ernste Kunst heute nur noch ironisch oder zynisch zu interpretieren ist? In den 70ern gab es noch Traditionen zu brechen, heute sind gar keine mehr auffindbar. Was, fragt Beyer, steckt hinter dem klassischen Text? Es braucht nicht viel Opernbegeisterung, um mitreden zu dürfen über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft in dieser Eröffnungsrunde. Dirk Baecker, ein Soziologe, der nicht oft in die Oper geht, versucht den Absprungpunkt zu markieren. Er denkt an Marthaler, Verdi, Kant – und kommt zu dem Schluss: An der Oper ist im Vergleich zu den anderen Künsten nichts Besonderes. Becker findet, dies sei eine beruhigende Aussage. Dann entdeckt er doch noch das Profil der Oper: Historizität, eine der Gattung innewohnende Differenz von Vergangenheit und Gegenwart.
Der einzige waschechte Praktiker auf dem Podium, Regisseur Tilman Knabe, schaut ungläubig: „Scheitern ist das, was Kunst ausmacht“, brummt er. Dann kommt Carl Hegemann, Castorf-Denker, Schlingensief-Verbündeter – und bleibt. Seine Schiller-Exegese gipfelt emphatisch: „Nur spielerisch können wir uns befreien.“ Noch etwas Luhmann dazugeben: Das Kunstwerk definiert sich durch eine relative Unwahrscheinlichkeit seines Zustandekommens. Wir erwarten immer schon das Unwahrscheinliche. Opern müssten deshalb das Kunststück vollbringen, gleichzeitig wie Kunst und wie Nichtkunst auszusehen, schlussfolgert Hegemann. In unserer Funktionsgesellschaft entdeckt er nur diese zwingenden Themen. „Liebe und Tod und sonst nichts – das will ich!“
Navid Kermani, habilitierter Orientalist, war 2012 in Bayreuth und hat darüber einen Artikel in der „Zeit“ veröffentlicht. Seine These: Wenn sie den Mund aufmachen, ist es schon vorbei mit der Oper. Weil man sie nicht mehr ernst nehmen kann. Überhaupt bewegten sich Sänger so wie vor 40 Jahren, gefangen in einer Ideologie der Einfühlung, die die Oper fest im Würgegriff habe. So wie diese These ihren Autor. Hegemann kann ohne Gegenwehr anfügen, dass ihm heute der rituelle Charakter fehlt auf der Bühne, die durch perfektes Handwerk entstellt werde. Er erinnert an den kürzlich verstorben Regisseur Dimiter Gotscheff, für den Theater Hort „heiliger Handlungen in der profanisierten Welt“ war.
Regisseur Knabe wird unruhig, sieht das Handwerk despektierlich behandelt: „Das ist schofelig, Herr Professor Hegemann.“ Doch längst redet nur noch einer, der Soziologe guckt glasig, der Regisseur grollt, der Wissenschaftler träumt. Carl Hegemann aber läuft mit Aischylos zur finalen Form auf: „Erobert euer Grab!“ Graue Locken wippen. Der Name Christoph Schlingensiefs fällt an diesem Nachmittag gefühlte 33 Mal, der Heiner Müllers 22 Mal.
Jonathan Meese sorgt für den humoristischen Höhepunkt.
Wesentlich entspannter verläuft am Folgetag das Zusammentreffen der Regisseure, jüngeres bis mittleres Semester. Auch das vorgegebene Müller-Wort „Wirkung und Erfolg schließen sich aus“ treibt niemandem mehr Schweiß auf die Stirn. Benedikt von Peter gibt gerne zu, seine Inszenierungen radikal anzubinden an das eigene Leben, so lange, bis „man die Theorie dahinter essen kann“. Die meiste Probenzeit gehe dafür drauf, dass man den Sängern das auch abnimmt. Die Stuttgarter Schule eines psychologischen Realismus à la Wieler/Morabito hingegen findet von Peter grauenhaft. Und weiß Gegenmittel durch neue Mannschaftsaufstellungen: „Bei mir sitzt das Orchester selten im Graben.“
Vera Nemirova bemerkt mit Mona- Lisa–Lächeln, dass ein Abend Kraft haben und die Leute erreichen müsse. Die Publikumsvertreter fühlen sich prompt gut behandelt vom Podium und lassen sich zu Liebeserklärungen an ihre Regisseure hinreißen: „Nehmen Sie uns bitte mit“ – und: „Gebt uns was zu denken und zu fühlen.“ Organisatorin Beyer kann da für die Regie nur noch ein intaktes Verhältnis zwischen „Beruf und Auftragslage“ konstatieren. Zufrieden scheint sie damit nicht, vom theoretischen Standpunkt betrachtet. Wieder wird eingehend Schlingensiefs gedacht.
Seinen humoristischen Höhepunkt erreicht das Symposium am Samstagnachmittag: Es geht um die Kunst – und eigentlich auch ihr Verhältnis zur Oper. Bald redet wieder nur einer: diesmal Jonathan Meese. Eigentlich sitzen noch eine Performerin und ein Komponist aus Österreich sowie ein griechischer Filmer auf dem Podium. Was also macht die Kunst? „Sie ignoriert das Publikum“, skandiert Meese – und sie ist immer kulturlos. Seine Augen blitzen, wenn er von der verhassten Kulturschickeria spricht und dem Gerichtsprozess, der ihm gemacht wurde, nur, weil er der Kunst diene. Immerhin spricht er auch über die Oper: „Dass ich nach Bayreuth eingeladen worden bin, ist ein gutes Zeichen. Da ist alles voller Liebe, voller Kunst, das ist ein Machtzentrum. Selbst Hitler wurde in Bayreuth zum Kind. Auch Merkel wird dort entpolitisiert.“ Der Sieg der Kunst scheint plötzlich nah.
Doch, es wird nicht nur über die kunstferne „Institution“ oder die dämonische Macht des „Apparats“ geklagt – es kommen auch Vorschläge aus der Künstlerrunde, um dem Unbehagen an der Oper zu begegnen: Hauskomponisten für alle Opernhäuser, ein Jahr lang mal zur Hälfte Werke von Frauen spielen. Oder wie Jonathan Meese es zusammenfasst: „Spielen, spielen, spielen. Auch wenn’s langweilig wird, weiter spielen.“ Für den Zuhörer bleibt am Ende des Symposiums vor allem das dringende Verlangen, der Oper kundigere und kommunikativere Liebhaber zu wünschen.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: