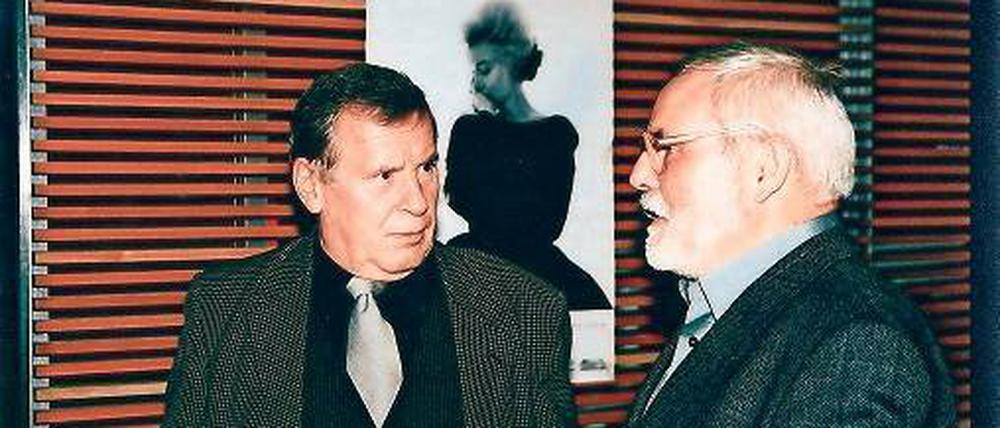
© privat
Landeshauptstadt: Als der Marmorkamin qualmte
In den 50er-Jahren war Schloss Babelsberg die Residenz der Filmstudenten. Vorbereitet auf die Dekadenz waren die wenigsten
Stand:
Die Filmuniversität Potsdam wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Als Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) hat sie Jahrzehnte des Filmschaffens in Babelsberg mitgeprägt. Ehemalige Studierende erinnern sich nun in den PNN an ihre Studienzeit.
In den ersten beiden Jahren nach der Gründung wohnten die Studenten der Deutschen Hochschule für Filmkunst im Babelsberger Schloss. Es war respektlos im Gefühl völliger Rechtmäßigkeit von den überwiegend dem proletarischen und Angestelltenmilieu entstammenden jungen Adepten der Filmkunst in Besitz genommen.
Wenn auch die Quartiere im Winter lausig kalt, zugig und schwer zu heizen waren, so ließen sich in dem neugotischen Festsaal mit seinem Sterngewölbe und der umlaufenden Galerie trefflich Sommerfeste feiern. Der Saal öffnete sich auf die große Terrasse, und der Springbrunnen, zwar nicht mehr im Betrieb, war aber doch mit Wasser so weit gefüllt, dass er den erhitzten Rock-’n’-Roll-Tänzern schnelle Abkühlung gewährte. Solche Internatsunterkünfte waren seinerzeit durchaus üblich, da im privaten Bereich kaum entsprechende Wohnraumreserven verfügbar waren.
Mit Beginn des Herbstsemesters 1956 endete die monarchistische Phase des Studentenlebens und wurde durch Bezug mehrerer durchaus repräsentativer Gebäude in der Villenkolonie Neu Babelsberg in unmittelbarer Umgebung des Hauptsitzes der Hochschule am Ufer des Griebnitzsees in eine bürgerliche, ja recht wohl großbürgerlich zu nennende, Lebensform übergeleitet. An die Stelle des weitläufigen, zum Havelufer abfallenden Schlossparks traten die großzügigen Gartenanlagen der verschiedenen Villen, in denen ursprünglich Bankiers, kaiserliche Generäle, Großindustrielle und Ufa-Stars gewohnt hatten. Ein Teil von ihnen, diejenigen „jüdischen Blutes“, mussten schon in den 30er-Jahren, die anderen nach Kriegsende ihren Besitz verlassen. Die anschließende Besetzung durch die Sowjetarmee war nun auch beendet.
In einem der Häuser beschlossen die neuen jungen Bewohner, in Anbetracht der schon herbstlichen Temperaturen die Einweihungsfete in der geräumigen holzgetäfelten Diele mit ihrem prächtigen Marmorkamin zu feiern. Aus dem verwahrlosten Garten wurde eilig Holz herbeigeschafft, überzählige Matratzen bildeten auf dem Parkettboden einen Halbkreis von bequemen Sitzgelegenheiten, Flaschen mit dem bulgarischem Rotwein der preiswerten Sorte „Gamza“ wurden entkorkt. Das Buschholz aus dem Garten muss wohl nicht ganz das Richtige gewesen sein, denn es wollte nicht brennen. War es vielleicht zu nass? Doch auch zur Unterstützung des Feuers zusammengeknülltes Zeitungspapier loderte nicht. Das Öffnen einer Tür und Freiwillige, die ihre Lungenluft einsetzen, brachten schließlich das Reisig zum Glimmen. Niemand wollte sich die romantische Stimmung eines Kaminfeuers vermiesen lassen, und so wurde mit Zigaretten der Marke „Jubilar“ vom VEB Jasmatzi und Selbstgedrehten aus „Westtabak“ gegen den beißenden Qualm aus dem Kamin angekämpft.
Etwas merkwürdig schien es schon: Das sollte nun die parasitäre Lebensweise der ehedem herrschenden Klasse sein? Etwas später erschien der Kommilitone „Pitty“ N. in der Tür zur Diele, sah sich verwundert um, schüttelte dann den Kopf und sagte mit einem mitleidigen Lächeln in die Runde: „Aber Kinder “ – Pitty redete häufig seine gleichaltrigen Mitstudenten mit „Kinder“ an. Er tat das ohne jede Überhebung oder gar Geringschätzung. Es schien Bestandteil seiner etwas distinguiert wirkenden Ausdrucksweise in stets einwandfreiem Hochdeutsch zu sein, die in seiner bürgerlichen Herkunft und Bildung wurzelte. „Aber Kinder “, sagte Pitty nach seinem Eintritt in die verqualmte Diele der Villa, ging entschlossen auf den Kamin zu, fasste mit sicherer Hand prüfend rechts und links an die Seite der Marmorverkleidung und eröffnete dann der versammelten Runde, dass es sich hier um einen „blinden“ Kamin, eine Attrappe ohne den notwendigen Schornsteinzug mit entsprechendem Querschnitt, handelte, die mitnichten für echtes Feuer, allenfalls für Gasflammen geeignet wäre. Es zeigte sich, dass auch die bürgerliche Lebensweise gelernt sein musste. Erschwerend kam hier allerdings hinzu, dass es sich offensichtlich um eine Form bürgerlicher Dekadenz handelte, auf die man noch weniger vorbereitet war.
Knapp 50 Jahre später war einem solch beschämenden Fauxpas bei der angemaßten Nachahmung unzuständiger Lebensform die Grundlage entzogen. Die Häuser der ehemaligen Villenkolonie Neu Babelsberg bargen wieder Bewohner in ihren sanierten Mauern, die einen echten Kamin von einer Attrappe zu unterscheiden wussten, obwohl manche elektrischen Kamine mit ihren täuschend echten Flammen es durchaus schwer machen konnten.
Der Autor studierte Filmproduktion an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg, heute Filmuniversität Babelsberg, sowie Komposition und Tonsatz an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Rabenalt arbeitete zunächst als wissenschaftlicher Assistent an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ und war hier ab Mitte der 1980er-Jahre Dozent für Ton- und Musikdramaturgie sowie später Professor für Film- und Fernsehdramaturgie. Auch nach seiner Emeritierung war er weiterhin als Gastprofessor für Dramaturgie an der HFF tätig
Peter Rabenalt
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: