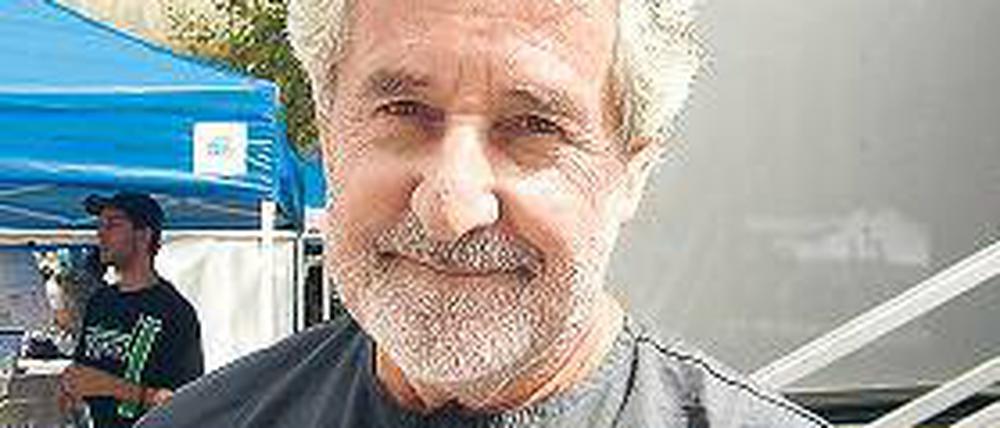
© nightscream/Wikipedia
Homepage: Der Mensch ist besser als sein Ruf
Einstein-Forum zum Thema Eigeninteresse
Stand:
„Wo haben Sie den denn her?“, fragt Susan Neiman erstaunt, als der südafrikanische Poet und Philosoph Breyten Breytenbach aus einem dreizehn Jahre alten Essay der Philosophin über den Journalist und Philosophen Jean Améry zitiert. „Das findet man, wenn man nach etwas Schönem forscht“, entgegnet Breytenbach. Darüber, ob der Poet das Kompliment ganz ohne Eigeninteresse macht oder Neiman mit intellektueller Brillanz schmeicheln möchte, kann nur spekuliert werden. Thema der Tagung des Einstein Forums, auf der dieser Wortwechsel stattfand, war jedenfalls der Eigennutz.
Der werde seit dem 19. Jahrhundert als Triebfeder menschlichen Handelns massiv überschätzt, war die Ausgangsthese der Tagung. Selbstinteresse sei selbst ein „historisch kontingentes Produkt kultureller Kräfte“, hieß es schon in der Einladung zur Tagung.
„Der Mensch ist viel altruistischer, als gemeinhin angenommen wird“, behauptet Martin Schaad, der stellvertretende Direktor des Hauses. Mithilfe der Spieltheorie hätten Wissenschaftler verschiedene Szenarien untersucht. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Handelnden meist zu überraschend großer Kooperationsbereitschaft neigen würden. Dies gelte selbst dann, wenn ein unmittelbarer Mehrwert fehle und keine Strafe drohe. Auch Psychologie und Neurobiologie würden diese Annahme bestätigen.
Auch wirtschaftliches Handeln sei entgegen allgemeiner Ansicht nicht ausschließlich auf eine Profitmaximierung ausgerichtet, sondern benötige stets einen Vertrauensvorschuss. „Der andere muss darauf vertrauen können, dass abgeschlossene Verträge und Transaktionen auch durchgeführt und gehalten werden“, sagt Schaad. Diese Annahme könne sicherlich enttäuscht werden und sei dann justiziabel, müsse aber erst einmal vorhanden sein. Allerdings vertraue die Gesellschaft immer noch auf Strukturen, die in vergangenen Jahrhunderten geprägt worden seien. Diese würden von einem dominierenden Eigeninteresse des Einzelnen für seine Handlungen ausgehen.
Diese These vertritt auch der amerikanische Jurist T.J. Jackson Lears. Am Beispiel des US-Rechtssystems zeigt er die Strukturen des Gerichtsprozesses auf. Dieser sei konfrontativ aufgebaut, jede der Parteien werde in eine Position gedrängt, in der sie nicht primär an der Wahrheitsfindung, sondern an der möglichst effektiven Durchsetzung der eigenen Position interessiert sei.
Am Beispiel der Bonobos, der Schimpansen und anderer Affen zeigt der Verhaltensforscher Frans de Waal auf, dass auch in der Tierwelt ein starker Sinn für Fair Play und ein erhebliches Einfühlungsvermögen für den Gattungsgenossen vorhanden ist. Dieses hätte über Jahrtausende die sozialen Gruppen im Tierreich dominiert und so das Überleben gesichert. Auch ohne einen Gott im Hintergrund vermuten zu müssen, gebe es also genug Grund für moralisches Handeln. Götter seien vielmehr von Religionsgemeinschaften wohl deshalb installiert worden, um schon bestehende Hierarchien durch eine übergeordnete, dominante Figur abzusichern.
Einen poetischeren Ansatz verfolgt Breyten Breytenbach. Der Poet und Polit-Aktivist verbrachte sieben Jahre in südafrikanischen Gefängnissen. Seine Heirat mit einer Französin vietnamesischer Abstammung verstieß gegen Apartheitsgesetze. Betrachtet durch das Prisma der eigenen Laufbahn, realisiere sich das menschliche Eigeninteresse mehr in gemeinschaftlichem Zusammenhalt als in tyrannischer Selbsterfüllung des Einzelnen, erklärt Breytenbach. Er unterstreicht dies mit einem sehr persönlichen Essay, in dem er sowohl auf die gegenwärtige ökonomische Krise wie auch auf die Spannungen im aktuellen Südafrika eingeht. Er vermutet, dass der Mensch sich seiner Handlungsantriebe, ob eigennützig oder nicht, ohnehin viel weniger bewusst sei als gemeinhin angenommen. „Das Dunkel und das Licht liegt im Unterbewussten verborgen. Das gemeinsame Fantasieren ist der Samen der Welt“, findet Breytenbach. Richard Rabensaat
Richard Rabensaat
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: