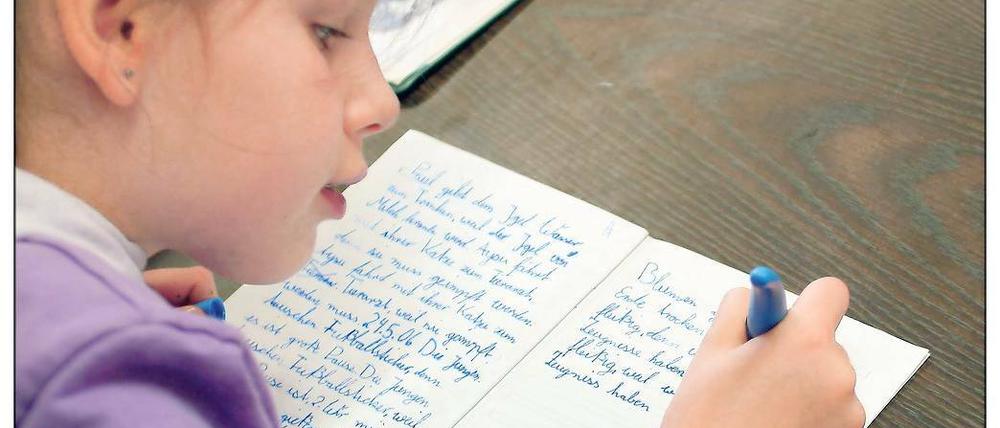
© Kitty Kleist-Heinrich
Landeshauptstadt: Die Rechtschreib-Bombe
Die „Lesen durch Schreiben“-Methode des Schweizer Reformpädagogen Jürgen Reichen bringt katastrophale Ergebnisse. Darin sind sich Bildungsexperten einig. An welchen Schulen sie aber unterrichtet wird, weiß das Land nicht. Nun will die CDU durchgreifen
Stand:
Wegen des ganzen Desasters mit der Rechtschreibung hat Henryk Wichmann seine Tochter von der Schule genommen. Nun fährt das Mädchen jeden Tag statt in die staatliche Grundschule im Ort in eine Privatschule in das 20 Kilometer entfernte Templin. Offensichtlich wurde das Drama, als eine neue Lehrerin in der damals dritten Klasse des Mädchens ein Diktat schreiben ließ: „Alle hatten ’ne Vier“, sagt Wichmann. „Da ist die Bombe geplatzt.“ Inzwischen hat er eine Dienstaufsichtsbeschwerde bewirkt.
Die Grundschule in Lychen unterrichtet nach der „Lesen durch Schreiben“-Methode des Schweizer Reformpädagogen Jürgen Reichen. Dabei verschriftlichen die Kinder Laute, wie sie sie hören, mithilfe einer Tabelle. Darauf sind alle Laute und Lautverbindungen mit Bildchen gekoppelt, etwa einer Spinne für „Sp“, die den Kindern helfen sollen, die richtigen Buchstaben zu finden. Die sogenannte Anlaut-Tabelle wird auch in Schulen in Potsdam und Umgebung benutzt.
In der Lychener Schule werde, so Wichmann, Reichen in Reinform unterrichtet. Das heißt: kein Leseunterricht und keine Korrekturen der oft unlesbaren Texte der Kinder, denn, so der Schweizer, das halte die Kinder nur vom freien Schreiben ab. „Wir können nachweisen, dass zwei Jahre lang nicht die Rechtschreibung korrigiert wurde“, sagt Wichmann. „Es ist verdammt schwer, mit entsprechender Therapie das wieder zu korrigieren.“
Für Agi Schründer-Lenzen, Professorin für Grundschulpädagogik an der Universität Potsdam, ist das Aufbegehren Wichmanns ein gutes Zeichen. „Ich kann diese Eltern nur unterstützen, wenn sie hinterfragen, was da eigentlich passiert? Auch aus anderen Bundesländern bekomme sie Zuschriften von Eltern, die die katastrophalen Rechtschreibe-Leistungen ihrer Kinder auf Reichen zurückführen. „Die Methode, wie sie Herr Reichen propagiert, ist keine gute Methode für Kinder, um Lesen und Schreiben zu lernen.“ Sie findet es „wirklichkeitsfremd, wenn man Kinder in einem normfreien Raum lässt“. Bei Mathe-Aufgaben würden ja auch keine falschen Lösungen akzeptiert. Zudem könnten auch Kinder in der ersten Klasse bereits auf Orthografie-Regeln hingewiesen werden. Die Leiterin des Potsdamer Duden-Instituts für Lerntherapie, Andrea Payk-Heitmann, sieht das ähnlich. Zwar sagt sie: „Lautgetreues Schreiben ist bis zum Ende der ersten Klasse nicht schlimm.“ Aber die Schüler zu lange schreiben zu lassen, wie sie wollen, sei ein „sehr fahrlässiger Ansatz“.
Da Henryk Wichmann von der CDU und Mitglied im Brandenburger Landtag ist, wurde aus dem Eltern-Aufschrei eine parlamentarische Anfrage und ein Antrag der Fraktion an den Landtag. So fragte Wichmann nach, welche Brandenburger Schulen nach der Reichen-Methode unterrichten. Das Bildungsministerium weiß das aber nicht. Für Wichmann die nächste Katastrophe: „Das sollten das Ministerium und die Schulaufsicht aber“, empört er sich. Alles würde das Ministerium überprüfen, „nur wie die Kinder Deutsch lernen, ist eigentlich egal“. Ob überhaupt eine Genehmigung für das verwendete Lehrbuch „Lara und ihre Freunde“ vorliege, fragt er weiter. Laut Ministeriumssprecher Stephan Breiding stehe das Buch nicht auf der Liste der zugelassenen Lernmittel. Doch es sei „pädagogische Freiheit“, nicht zugelassene Bücher ergänzend einzusetzen. Die Bildungsexpertin Schründer-Lenzen sieht hier kein Verschulden der Landesregierung: Die Freiheit, die Unterrichtsmethoden und -materialien selbst zu bestimmen, sei etwas Wichtiges und Wertvolles. Schließlich wolle man ja keinen Unterricht mehr im Gleichschritt. Bücher auf den Index zu setzen, hat für sie „einen ganz schlechten Beigeschmack“.
Die CDU fordert jetzt konkrete Maßnahmen. Die Regierung soll die Rechtschreibefähigkeiten der Grundschüler verbindlich prüfen. Die Vergleichsarbeiten „Vera 3“ in diesem Schuljahr im Bereich Orthografie seien verpflichtend einzuführen. Bislang sind die Tests freiwillig. Es sei Aufgabe guter Bildungspolitik, zu überprüfen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen dem schlechten Abschneiden des Landes und dem Einsatz der Lehrmethode des lautorientierten Schreibens bestehe. Ministeriumssprecher Breiding hingegen sieht keine Notwendigkeit für weitere zwangsweise Tests. Die Orthografie-Fähigkeiten würden bei den Orientierungsarbeiten in Klassenstufe 2 und 4 überprüft. Auch gebe es individuelle Lernstandsanalysen, die Lehrer in den ersten drei Klassenstufen durchführen können. „Das reicht aus.“
Das Land Berlin rät seit vergangenem Jahr Schulen von der Reichen-Methode ab. Brandenburg hat solch eine Empfehlung bislang nicht ausgesprochen.
AUS DER SCHUL-PRAXIS
„Nur Ansätze davon“
Schulen, die vor einigen Jahren die „Lesen durch Schreiben“- Methode angewandt haben, nehmen jetzt nur noch das Beste davon. „Das Geniale daran ist, dass man Kinder damit schnell zum freien Schreiben führen kann“, sagt Katharina Kupsch von der Freien Schule im Bisamkiez. Sie lobt den spielerischen Zugang zum Schreiben. Außerdem setze die Methode dort an, was die Schüler schon könnten. Auch für Quereinsteiger, die von staatlichen Schulen „mit einer perfekten Schreibschrift, aber furchtbarer Angst vorm Schreiben“ zu ihnen kämen, sei die Methode geeignet. Nach einer Testphase sind sie und ihre Kollegen aber schnell wieder zu Korrekturen der Texte, die die Kinder produziert haben, zurückgekehrt. Schließlich habe es Rückmeldungen von weiterführenden Schulen gegeben, dass die Schüler Schwächen in Orthografie hätten. Die Evangelische Grundschule in Babelsberg arbeitet ebenfalls mit der Anlaut-Tabelle. „Unser Ansatz zum Lesen- und Schreibenlernen beinhaltet zwar Aspekte des Konzeptes ’Lesen durch Schreiben’, ist aber von der eigentlichen Idee deutlich entfernt“, sagt Schulleiterin Susanne Anders. „Wir arbeiten sehr viel systematischer als es das Konzept von Herrn Reichen vorsieht.“ Die Grundschule am Kiefernwald in Wildenbruch hat vier Jahre lang ausschließlich mit der Methode des Reformpädagogen gearbeitet. „Die Rechtschreibung war grauenvoll“, sagt Schulleiterin Astrid Kühnel. Nun sei man dabei, die Fehler wieder auszubügeln. „Bei manchen haben wir es nicht geschafft, da kämpfen die Lehrer heute noch gegen die schlechte Rechtschreibung.“ Kühnel findet Ansätze der Methode „sinnvoll für die, die schon ein bisschen weiter sind, etwa bei Geschwisterkindern“. Inzwischen ist die Schule aber auch zur klassischen Fibel zurückgekehrt. (giw)
Grit Weirauch
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: