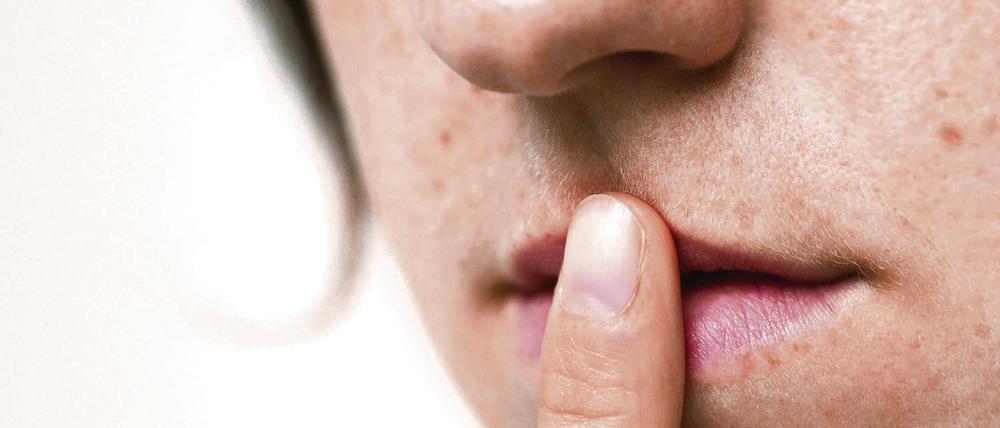
© dpa
Von Mark Minnes: Ein ewiger Streit
300 Sprachwissenschaftler konferierten an der Uni
Stand:
Kaum ein anderes Phänomen übt eine so anhaltende Faszination auf die Menschen aus, wie die Sprache. „Man bedenke“, so der Philosoph Jean-Jacques Rousseau 1755, „die unausdenklichen Mühen, welche die erste Erfindung der Sprache gekostet haben muss.“ Auch lässt sich über kaum einen anderen Gegenstand so vortrefflich streiten, und das seit Jahrtausenden. Von Platon und den alten Griechen, über Rousseau und die Aufklärung, bis in die aktuellste Gegenwart reichten die Themen der „11. Internationalen Konferenz für die Geschichte der Sprachwissenschaft“. Am Dienstag ging an der Uni Potsdam das sechstägige Treffen von 300 Sprachwissenschaftlern aus 35 Ländern zu Ende. Ein beeindruckender Marathon linguistischen Nachdenkens: allein das Verzeichnis der Vorträge und Workshops umfasste 12 Seiten. Das von der Romanistin Prof. Gerda Hassler organisierte Großereignis war eine der umfassendsten Konferenzen, die jemals an der Philosophischen Fakultät der Uni stattgefunden haben.
Oftmals ging es um Grundsätzliches. So bei Avi Lifschitz, vom University College London. „Sprache ermöglicht einen mysteriösen Sprung von der Natur in die Zivilisation“, erhellte Lifschitz in einem der ersten Vorträge der Konferenz eine Obsession des französischen Aufklärers Jean-Jacques Rousseau. Dieser Sprung in das Sprechen erscheint damals wie heute als ein geheimnisvoller Vorgang, der das Tier zum Menschen macht. Trennt die Sprache den Menschen also vom Rest der Natur, von der Welt der Tiere? Ist die Sprache, wie der Philosoph René Descartes meinte, etwas rein Geistiges, dem körperlich-tierischen streng Entgegengesetztes?
Diese Frage schien den Aufklärern des 18. Jahrhunderts von größter Bedeutung. Heftige Polemiken um das Wesen und die Funktion der Sprache waren die Folge. Polemiken, die bis heute andauern, so der Ideengeschichtler Lifschitz nach seinem Vortrag. Auch heute macht für manche Leute die Sprache den Menschen zur Krönung der Schöpfung. Für biologistisch denkende Gegner dieser Position ist Sprache aber eher eine Art Instinkt, der den Menschen keineswegs von den Tieren abhebt. „Ich kann diese Probleme nicht lösen“, lächelte der souverän wirkende israelische Historiker. Dennoch fasziniere ihn die andauernde Aktualität sprachphilosophischer Fragen. Er habe sich an dem Thema festgebissen, gab Lifschitz schließlich zu.
Waren Ursprung und Funktion der Sprache also der große Streit des 18. Jahrhunderts, so erhitzte im 19. Jahrhundert die Sprachwissenschaft selbst die Gemüter. Die heutige Sprachwissenschaft entstand in den Universitäten dieser Zeit. Christine Blauth-Henke und Johanna Wolf, junge Sprachwissenschaftlerinnen aus Tübingen und Kassel, beleuchteten die Entstehung ihres eigenen Faches. Ein Prozess, der in der Abspaltung der Neuphilologien von der altbekannten Beschäftigung mit dem Griechischen und Lateinischen begann. Ein Prozess, der sich dann in der Aufspaltung der Neuphilologie selbst fortsetzte. Und was für die Aufklärer galt, gilt auch für die zumeist deutschen Philologen ein Jahrhundert später: Grund für Streit gab es reichlich.
„Zwei Arten des Sprachstudiums sind in mir zum Zwiespalt geworden“, befand Jacob Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Friedrich Schlegel forderte 1808 für das Sprachstudium eine Orientierung an der vergleichenden Anatomie. So entstand um Philologen wie Friedrich Diez und Franz Bopp eine neue Disziplin, die Sprache um ihrer selbst willen betrachtete. Die damals aufstrebende Wissenschaft der Medizin lieferte das Vorbild für die ausgeprägte Abneigung der jungen Sprachwissenschaft gegen spekulative Hypothesen. Die hohen methodischen Ansprüche der Sprachwissenschaftler sorgen noch heute für reichlich Streit mit den Literaturwissenschaftlern. Die beiden frisch geborenen Zweige der Neuphilologien sind seit über 150 Jahren in trauter Zwietracht geeint.
Die Ironie der Geschichte: heute befindet sich die traditionelle Sprachwissenschaft selbst unter dem Druck einer neuen Disziplin, die zunehmend den Begriff der Wissenschaftlichkeit für sich beansprucht. Es handelt sich um eine kognitionswissenschaftliche Linguistik, die mit neurobiologischen, psychologischen und mathematischen Disziplinen verknüpft ist. Auch an der Uni Potsdam ist diese neuere Zweiteilung der Sprachwissenschaft spürbar. Nicht nur, dass es ein von den Philologien getrenntes Institut für Linguistik gibt. Seit Juli 2008 sollen nach Willen des Präsidiums der Uni die Kognitionswissenschaften zu einem eigenen Exzellenzbereich aufgebaut werden.
Das akademische Feld der Sprachwissenschaft ist also in Bewegung, nicht nur in Potsdam. Für die Organisatorin der Konferenz Prof. Gerda Hassler war dies einer der Gründe für den großen internationalen Zuspruch, den die Konferenz erlebte. Derzeit sei ein kritischer Blick in die Vergangenheit der Disziplin besonders gefragt. So zeigte das Gelingen der Konferenz, dass jeder Streit auch sein Gutes hat.
Mark Minnes
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: