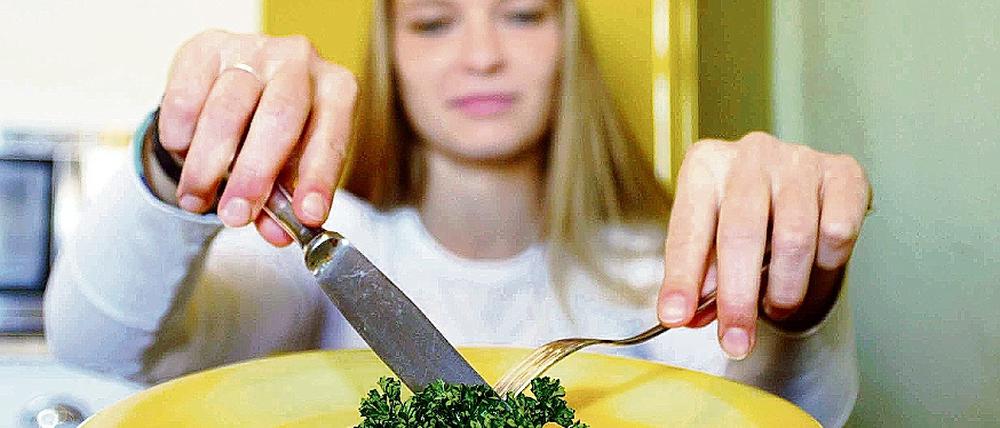
© ddp
Von Sophia Sabrow: Ist Fasten gut für die Gesundheit?
Potsdamer Ernährungsforscherin bestreitet eine medizinische Wirkung des Nahrungsverzichts
Stand:
Die Wochen zwischen Karneval und Ostern sind für viele eine persönliche Herausforderung: Die einen verzichten auf Süßigkeiten oder Kaffee, die anderen auf Alkohol und Zigaretten. Sieben Wochen vor dem Osterfest, am Aschermittwoch, beginnt nämlich die Fastenzeit. Ganz Hartgesottene orientieren sich an der eigentlichen Bedeutung des Wortes „Fasten“ und verzichten gänzlich auf feste Nahrung – zwar nicht für sieben, aber dennoch für ein oder zwei Wochen.
Das sogenannte Heilfasten gilt gemeinhin als sehr gesundheitsfördernd. Durch den längeren Nahrungsverzicht soll sich der Körper von Giftstoffen und Schlacken befreien, die sich im Laufe der Zeit im Darm anlagern. „Das kann man sich wie bei einem verrußten Ofen vorstellen, der erst dann wieder gut zieht, wenn er geputzt wird“, erläutert die Medizinerin Eva Lischka. Eine solche jährliche „Reinigung“ würde die körpereigenen Abwehrsysteme nachhaltig stärken.
Eva Lischka ist eine von etwa 100 Fastenärzten in Deutschland und praktiziert in der Buchinger Fastenklinik am Bodensee. In solchen Kureinrichtungen können die Patienten den bewussten Nahrungsverzicht unter Aufsicht geschulter Ärzte durchführen.
Einige Wissenschaftler sind von der medizinischen Wirkung des Fastens jedoch nicht überzeugt. Susanne Klaus vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Bergholz-Rehbrücke stellt besonders den Begriff „Entschlacken“ infrage. „Niemand konnte mir bisher erklären, was diese Schlacken eigentlich sein sollen. Bei einem gesunden Stoffwechsel werden unverwertbare Endprodukte einfach ausgeschieden und lagern sich nicht im Körper ab.“ Auch die Ausdünstungen über Atem und Haut während des Fastens seien nicht Teil eines Entgiftungsprozess, wie Fastenvertreter meinen, sondern würden von sogenannten Ketonkörpern verursacht. Diese werden vom Körper bei Nährstoffmangel produziert, um das Glucosedefizit auszugleichen und anschließend abgeatmet, erklärt die Ernährungsphysiologin.
Seinen Ursprung nahm das österliche Fasten in der christlichen Religionslehre. In Vorbereitung auf das Fest, die Auferstehung Christi, gilt die Enthaltsamkeit als Zeichen der inneren Reinigung und Buße. Sie erinnert an die 40 Tage, die Jesus ohne Nahrung in der Wüste verbracht hatte, um sich auf sein öffentliches Wirken vorzubereiten.
Zwar wird der ehemals ausschließlich symbolische Charakter des Fastens heutzutage um den praktischen Wert, nämlich den einer besseren Gesundheit, erweitert. Dennoch ist der medizinische Erfolg des Fastens Eva Lischka zufolge nicht allein in dem punktuellen, zeitlich begrenzten Nahrungsverzicht begründet. Vielmehr soll das Fasten Anstoß für eine nachhaltige Entwicklung sein. „Fasten ist der Einstieg in eine andere Lebensführung“, erklärt die Ärztin. Die Geschmacksnerven würden sensibilisiert werden, und die Patienten hätten hinterher mehr Lust auf Obst und Gemüse. Viele von ihnen würden nach dem Fasten ihre Ernährung dauerhaft umstellen und wesentlich bewusster essen.
„Fasten ist die Antwort auf unsere Zivilisationskrankheiten, auf Überernährung und Bewegungsmangel“, fasst Eva Lischka zusammen. Bei solch ungesundem Lebenswandel würde man nämlich inneres Bauchfett ansetzen, das zu hohem Blutdruck und Diabetes führen kann. Regelmäßiges Fasten würde dieses schädliche Fett „einschmelzen“.
Demgegenüber hält Susanne Klaus vom DIfE das Fasten für keine geeignete Methode, um Fett zu verlieren oder abzunehmen. Bei einer solchen „Radikalkur“ kann es nämlich leicht zu dem berühmten Jojo-Effekt kommen: Der Körper stellt bei plötzlichem Nahrungsverzicht auf den Hungerstoffwechsel um und verringert seinen Grundumsatz. Werden nach dem Fasten die alten Essgewohnheiten wieder aufgenommen, setzt man oft mehr Pfunde an, als man zunächst verlor.
Auch die von Fastenärzten oft angeführte Behauptung, Fasten würde das Immunsystem stärken, enttarnt die Ernährungswissenschaftlerin: „Selbstverständlich ist das Immunsystem während des Fastens weniger angeregt. Man nimmt ja keine Bakterien mit der Nahrung auf, wenn man nichts isst.“ Es würde dem Abwehrsystem allerdings keineswegs schaden, die unverwertbaren Stoffe auszuscheiden, die ihm bei normaler Ernährung zugeführt werden.
„Positive medizinische Effekte sind dem Fasten nicht nachgewiesen worden“, stellt Susanne Klaus fest. Für Scharlatanerie hält die Ernährungsphysiologin das Fasten dennoch nicht. „Fasten kann durchaus eine psychologische Wirkung haben.“ Viele Menschen würden die Fastenwochen nutzen, um sich eine Ruhepause vom Alltagsstress zu gönnen und sich Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu nehmen. Seriöse Fastenkliniken bieten dafür einen geeigneten Ort: Hier wird den fastenden Gästen ein ganzes Rundum-Verwöhnprogramm angeboten, angefangen von Meditationsübungen und Massagen über Konzerte und Vorträge bis zu Wanderungen oder Nordic Walking.
Hungern hat allerdings seinen Preis: Für zwei Wochen Kuraufenthalt in einer renommierten Klink sind in der Regel 3000 Euro fällig. Aber man kann ja auch allein für sich Zuhause fasten.
Sophia Sabrow
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: