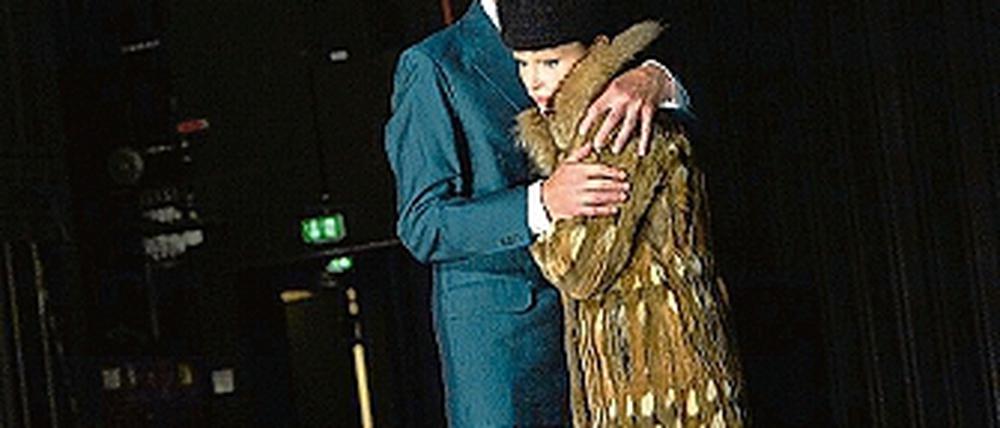
© HOT/Aurin
Kultur: Auch Abschied kostet Energie
Der Intendant, Schauspieler und Regisseur Uwe Eric Laufenberg verlässt nach fünf Jahren Potsdam
Stand:
Sie wählten für Ihr Potsdam-Finale Tschechows „Kirschgarten“, ein symbolträchtiges Stück über Abschied und Erinnerung, in dem am Ende die Kirschbäume abgeholzt werden. Was sind Ihre Kirschbäume?
Das Stück ist rund 100 Jahre alt. Es wird darin unter anderem ein Schrank besprochen, welchen Wert er hat und für was er steht. In dem Schrank sehe ich ein Gleichnis für das Theater. Es wird immer jünger und moderner. Mein Herz hängt aber auch an der Form des „alten“ Theaters. Würde der „Kirschgarten“ abgeholzt werden, bliebe nur das moderne Theater übrig. Und das wäre zu wenig.
Die Rolle der Gutsbesitzerin Ranjewskaja haben Sie mit Angelica Domröse besetzt.
Es war die Idee meines persönlichen Referenten, Hans Nadolny, ein Verabschiedungsstück mit dem Ensemble zu inszenieren. Dass nun wieder ein Gast dabei ist, liegt daran, dass Rita Feldmeier lieber ins Theater am Kudamm ging, um dort mit ihrem Mann zu spielen, statt diese dicke Rolle zu übernehmen.
Ist Ihr Konzept, mit dem Sie vor fünf Jahren in Potsdam antraten und das auf eine Symbiose von festem Ensemble und bekannten Gästen setzte, aufgegangen?
Es ist ein absolut gutes, nur zu empfehlendes Konzept. Diese Form des Miteinanders sorgte dafür, dass keiner auf Besitzstände guckt. Und alle Schauspieler spielten wie die „Idioten“, Moritz Führmann brachte es beispielsweise bis auf 33 Vorstellungen im Monat. Das ganze Ensemble hat wahnsinnig viel gearbeitet. Und es gibt mit Gästen eine ganz andere Öffnung, durch die man sich in seinen Spielweisen gegenseitig überrascht. Das Ensemble eiert nicht in der Kantine rum, wer wieder woran Schuld ist, dass dies und jenes nicht läuft. Es lernt vielmehr von den Protagonisten, wie man kämpft, auch wenn die Kritik mal schlecht ist. Das tun Spitzenleute, die freischaffend sind, viel eher, als Angestellte, die sich unter einer Gewohnheitsglocke wissen. Die Freiheit ums Überleben setzt andere Kräfte frei. Anderseits müssen die Gäste nicht ans schwarze Brett und sich überraschen lassen, in welcher Rolle sie besetzt werden. Sie entscheiden selbst, wo sie mitspielen. Die Gäste haben das Ensemble mit stark gemacht und dadurch ein bisschen Anarchie bewahrt.
Ihre Vorliebe für Tschechow ist bekannt. Ist es Ihr erster Kirschgarten?
Das Stück verfolgt mich schon seit meiner Jugend. Ich hatte versucht, es während meiner Schulzeit zu inszenieren, doch das ging gründlich schief. Ich probte es drei Monate mit meinen Mitschülern, aber es kam nicht zur Premiere. Es war viel zu schwer.
Sind Sie prinzipiell dagegen, Stücke gegen den Strich zu bürsten?
Nein. Aber ich habe mich in Potsdam nie an ästhetischen Debatten beteiligt. Ich wollte, dass die Potsdamer wissen, dass sie das, was der Titel verkündet, auch bekommen. Als ich vor fünf Jahren nach Potsdam kam, ging es darum, wieder Vertrauen zu schaffen.
Aber statt Stetigkeit sorgten Sie erst einmal für Bewegung.
Anderenorts hätte ich es vielleicht anders gemacht. Aber in die Blechbüchse wollte ja keiner gehen, also suchte ich Alternativen, die funktionieren.
Nun wechseln sie an die Kölner Oper. Wurde es Ihnen in Potsdam mit dem festen neuen Haus zu langweilig?
Nein, aber ich wollte ein neues Konzept für Potsdam und habe es auch der Stadt vorgestellt. Doch dort bin ich abgeblitzt.
Was schwebte Ihnen vor?
Ich wollte mehr Qualität statt Quantität, vielleicht statt zehn Premieren sechs. Doch die Stadt möchte lieber in der B-Liga spielen als in der A-Liga, obwohl es für den Aufstieg nicht unbedingt mehr Geld braucht. Man muss es nur gezielter in die Produkte einsetzen, an die man glaubt. Außerdem wollte ich das Kinder- und Jugendtheater ausgliedern und eigenständig im Land Brandenburg touren lassen, so dass es bis in die Uckermark Zuschauer erreicht. Es gab dazu erste Gespräche mit dem Oberbürgermeister und der damaligen Beigeordneten Gabriele Fischer, aber die meinten, dass das die Stadt und das Land überfordere. Ich hätte auch die Theatersaison ganz anders gelegt. Gerade im Sommer, wo in Berlin und andernorts Theaterferien sind, hätte ich unser Haus am Wasser geöffnet.
Wären Sie unter Umständen auch geblieben?
Jakobs hatte mir eine Verlängerung angeboten, es schien mir aber schwierig, sich über die Voraussetzungen zu einigen. Köln kam für mich im richtigen Moment. Außerdem hat Gabriele Fischer mich gehasst. Wir hatten da ein paar Auftritte, als ich zum Beispiel dem Technischen Direktor, Karl-Heinz Krämer, wegen der Akustik eine Abmahnung schicken sollte, was ich natürlich nicht tat. Ebenso wenig wie die Abonnenten ausladen zur Theatereröffnung, dass mehr Platz für die Politiker wäre. Ich war schon immer sehr frech. Jann Jakobs finde ich durchaus sympathisch, aber er war sehr beschäftigt, die Strömungen in seiner Partei und Verwaltung auszuloten. Es ist schwer eine Richtung vorzugeben ohne richtige Partner.
Gehen Sie auch, weil es in Potsdam keine Oper gibt?
Als ich hier her gekommen bin, wusste ich ja, dass es keine Oper gibt. Man hat mich dann später von außen „gezwungen“, innerhalb des Projektes „Winteroper“ zu inszenieren und es war ein Erfolg. Jetzt, wo es funktioniert, ist die Zukunft wieder ungewiss. Das sind die Rätsel der Landes- und Stadtpolitik.
Welche Flops und welche Tops haben Sie hier gelandet?
Mein größter Erfolg war „Frau Jenny Treibel“. Zwei Wochen vor der Premiere dachte ich noch, wir müssten Karten verschenken, weil es kaum Nachfragen gab. Jetzt haben wir es hundert Mal gespielt und es könnte noch hundert Vorstellungen geben. Den größten Flop hatten wir dann ebenfalls mit Fontane. „Der Stechlin“ in der Gastregie von Roland Schäfer, mit dem meine letzte Potsdamer Spielzeit eröffnet werden sollte, kam nicht zur Premiere. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas als Intendant passieren könnte. Die Inszenierung war nicht zu retten. Das war meine größte Niederlage.
Ansonsten setzten Sie vor allem auf feste Regisseure. Ging das gut?
Dazu muss ich sagen, dass wir uns eine bestimmte Kategorie von Regisseuren mit unserem Etat nicht leisten konnten. Also nahm ich Jüngere. Tobias Sosinka gelang es nicht, sich auf Dauer durchzusetzen: nicht beim Ensemble, nicht beim Publikum. Mit Petra Luisa Meyer ging es indes sehr gut. Natürlich ist es mit jungen Leuten ein schwierigerer Prozess, weil man meist in den Endproben noch sehr lange debattieren und arbeiten muss. Andererseits will man als älterer Regisseur nicht immer etwas vorschreiben.
Was wollen die Potsdamer sehen, was funktioniert nicht?
Die Wochenenden im Kinder- und Jugendtheater laufen schlecht, Klassiker gehen kaum. Dieses Phänomen ist gerade jetzt wieder zu spüren. Deshalb muss man in Potsdam immer wieder Ausrufezeichen setzen, um in der Konkurrenz von Berlin wahrgenommen zu werden. Unsere 1400 Abos füllen nicht das Theater. Wir müssen unsere Einnahmen an der Abendkasse erspielen. Dafür habe ich immer wieder Hirn und Herz bewegt. Es genügt nicht, nur auf die Stadt zu gucken. Mit dem „Idealen Gatten“ erreicht man etwa 5000 Potsdamer, die sich herrlich amüsieren. Doch in Berlin redet kein Mensch darüber. Bei „Jenny Treibel“ kommen die Besucher von überall. Also muss man Aufführungen machen, die in einen Umkreis von 50 Kilometer ausstrahlen.
Was sind die Erfolgsrezepte?
Ein bekannter Autor wie Fontane, dazu ein ungewöhnlicher Spielort, wie wir ihn im Palais Lichtenau fanden, dann eine innovative Spielform wie die Reise durch mehrere Räume, dazu ein tolles Ensemble und eine Spitzendarstellerin, wie in dem Fall Katharina Thalbach.
Was waren die Highlights neben der Treibel?
Die fünf Premieren zur Hauseröffnung, die Winteroper mit all’ ihren Verrücktheiten, auch politisch wichtige Stücke wie das über die Politkowskaja, die Satanischen Verse oder Staats-Sicherheiten. Aber dann fliegen wieder Dinge, von denen man dachte, die funktionieren, weg. Gute Inszenierungen wie Dantons Tod oder Der Fall Janke sind nur halb voll, weil der Star fehlt oder der richtige Titel.
Was müsste in der Schiffbauergasse passieren, dass dort richtig Leben einzieht?
Das fängt mit der Beleuchtung an. Und man muss sich etwas für das ganze Jahr ausdenken, auch mit Ausstrahlung nach Berlin. Bislang wurde es in der Stadtverwaltung nicht geschafft, jemanden das Vertrauen als Standortmanager auszusprechen. Der Stadt geht es eigentlich gut, aber sie tut so, als trüge sie ein Armenkleid.
Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Ich hätte nicht gedacht, dass das Verabschieden genauso viel Energie kostet wie ein Anfang. Es war eine sehr intensive Zeit, die ich nicht missen möchte: Ich habe das Theater in seiner kritischsten Zeit überleben lassen und es dabei in seiner Struktur erhalten.
Anders als Ihr Nachfolger.
Jetzt wird das Kinder- und Jugendtheater quasi abgeschafft, alles läuft über Jugendklubs. Das ganze Geld soll ins große Haus fließen. Ich wünsche Herrn Wellemeyer jedenfalls alles Gute.
Gibt es zwischen Ihnen eine Konkurrenz?
Wir verstehen uns gut, weil wir so anders sind. Jeder ist von dem überzeugt, was er macht. Deshalb müssen wir uns nicht messen. Ich gehe jetzt zur Oper, er gibt sie auf, wenn er Magdeburg verlässt.
Sie geben noch mehr auf.
Ich war Intendant, Schauspieler, Regisseur für Schauspiel und Oper. Jetzt bündele ich meine Kräfte. Ich kann nicht nur senden, sondern muss auch empfangen.
Werden Sie Potsdam vermissen?
Potsdam wird immer schöner, meine Heimatstadt Köln ist dagegen hässlich. Sie ist fast so alt wie Rom, aber sie sieht aus wie Neapel, seit dem Umzug der Regierungsbeamten nach Berlin. Mit „Kalle“ Krämer, der mit mir gemeinsam an die Oper geht, sitze ich schon jetzt zusammen und wir palavern darüber: „Weißt Du noch in Potsdam ...?“
Das Gespräch führte Heidi Jäger
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: