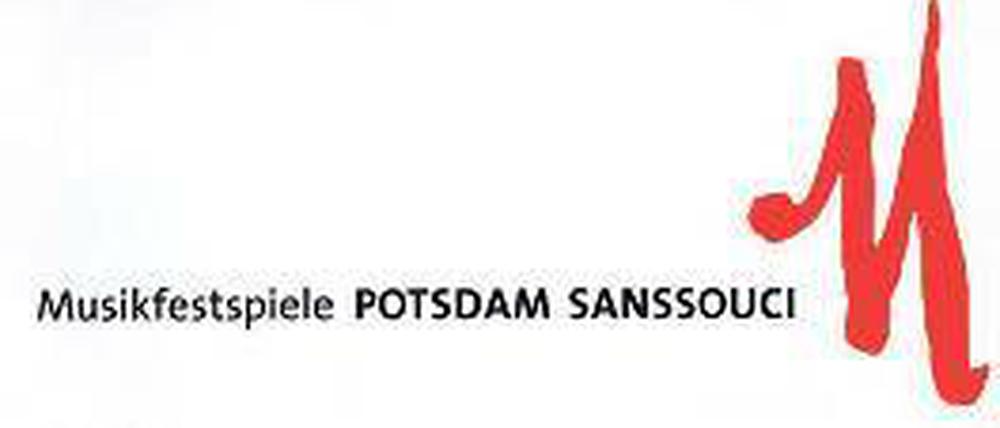
© pr
Kultur: „Es geht um Lebenslust“
Nächste Woche beginnen die Musikfestspiele – Ein Gespräch mit dem Dramaturgen Carsten Hinrichs
Stand:
Herr Hinrichs, stimmt es, dass die Idee für die „Sehnsucht nach der Ferne“, dem Programm der in der kommenden Woche beginnenden Musikfestspiele, bei einer Fahrradtour entstanden ist?
Ja, als ich 2008 nach Potsdam kam, eingeladen von der Künstlerischen Leiterin Andrea Palent, zukünftig gemeinsam die Musikfestspiele zu planen, sind wir zuerst die Wege zu den unterschiedlichen Konzertsälen in den historischen Schlössern und Gebäuden mit dem Fahrrad abgefahren, um zu sehen, was das für Räume sind, welche Musik da möglich ist. Und was mir als Nichtpotsdamer sofort auffiel, war die Fülle von exotischen Bauwerken, die von der Sehnsucht der Ferne erzählen, ohne ein genaues Abbild der Ferne zu geben.
Und was haben Sie damals als Nichtpotsdamer genau entdeckt?
Unter anderem das Chinesische Haus und die Moschee von Sanssouci. Aber auch innerhalb der Gebäude gibt es in Form von Bildern, von Schmuck oder Tappesserien diese Sehnsucht nach dem Fremden. Im Mamorpalais gibt es ein orientalisches Zeltzimmer mit einem Diwan, im Schloss Charlottenburg eine ganze chinesische Galerie. Das war im Grunde eine Steilvorlage für uns, ein musikalisches Programm zu machen, in dem wir uns der Sehnsucht nach der Ferne widmen, wie sie gerade hier an diesem Ort von den preußischen Königen geträumt worden ist und sich in all den Bauwerken und zahlreichen Kunstgegenständen wiederfindet.
Eine Sehnsucht nach der Ferne, die Sie vor allem mit Musik europäischer Komponisten vermitteln?
Die Grundfrage für uns war: Wollen wir Weltmusik zur Aufführung bringen und dann die Musiker aus den jeweiligen Ländern einladen oder soll es europäische Musik sein.
Und was hat den Ausschlag für eine Entscheidung für die europäische Musik gegeben?
Da hat uns wieder der Blick auf die Häuser und die Kunstwerke geholfen. Denn was sehen wir wirklich, wenn wir vor dem Chinesischen Haus stehen? Da sind Männer mit langen Bärten, die europäische Gesichter haben, daneben dann Buddhafiguren. Das ist ein reines Maskenspiel. Denn für den Mitteleuropäer war Asien damals ein schlafender Riese, ein Land der Kirschblüten und ewigen Weisheiten. Dieser europäische Blick auf das Ausland prägte die Sehnsucht nach der Ferne auch in der Musik.
Mehr interessierte nicht?
Es reichte die Staffage, die Maske. Man wollte mit dem Exotischen spielen. Es ging um Lebenslust, um Spaß an der Verkleidung und einer sinnlichen Auseinandersetzung mit dieser Ferne. So haben wir dann in der europäischen Geschichte nach dem musikalischen Pendant der jeweiligen Epoche gesucht und so ein Programm gestaltet, das wieder die alte Einheit herstellt zwischen dem historischen Bauwerk und der Musik, die dort gespielt wurde.
Dann spiegeln sich in den Kompositionen, den Bauten und Kunstwerken vor allem die Sehnsuchtsklischees der Europäer wider?
Uns fällt es heute natürlich leicht, von Klischees zu sprechen, weil wir einen Blick auf China haben, der an der Realität zumindest geschult ist. Und wenn wir heute auf das damalige Abbild des Fremden wie beispielsweise im Chinesischen Haus schauen, empfinden wir das wohl vor allem als kitschig.
Aber sind unsere Hörgewohnheiten, was das Fremde betrifft, nicht auch heute noch von bestimmten musikalischen Klischees bestimmt?
Als Mozart im Zuge der Türkenmode seinen „Türkischen Marsch“ komponierte, wird das wohl kaum ein Türke als türkische Musik empfunden haben. Damals wurde türkische Musik immer nur aus der europäischen Sicht adaptiert. Heute ist das natürlich anders, fließen Elemente fremdländischer und europäischer Musik wie selbstverständlich zusammen. Aber es gibt bestimmte Melodien, die wir hören und sofort an China denken. Ob auch ein Chinese, wenn er diese Melodie hört, an China denkt, sei dahin gestellt. Das ist eine Errungenschaft der Filmmusik, die ebenfalls in unser Programm eingeflossen ist. Was früher die Masken waren, ist heute die Filmmusik, deren Aufgabe auch darin besteht, uns mit ganz einfachen Mitteln ein ganz klares Bild zu suggerieren, ohne dass es dabei groß um Authentizität geht. Darum plädiere ich dafür, sich von dieser doch überheblichen Sichtweise zu verabschieden und sich darauf einzulassen, wofür diese Sehnsucht nach der Ferne damals stand: Für einen Ausdruck von Lebenslust.
Eine Musikerin, die diese Lebenslust sehr gut zum Ausdruck bringt und auch bei den Musikfestspielen auftritt, ist Christina Pluhar.
Ja, und der Erfolg von Christina Pluhar und ihrem Ensemble L’Arpeggiata gründet vor allem darauf, dass sie barocke Bassmodelle zur Improvisation nehmen und das dann mit Volksliedern, beispielsweise aus Neapel, kombinieren und daraus eine ganz lebendige und spritzige Musik machen. Alte Musik, die von Weltmusik beeinflusst ist oder auch Weltmusik als Motiv nimmt.
Ist das Programm „Sehnsucht nach der Ferne“ unter diesem Aspekt der Weltmusik als Motiv vor allem auch als eine Art musikalische Weltreise zu verstehen?
Wir laden nicht nur zu einer, sondern zu mehreren Weltreisen ein. Da ist die Lesung von Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“, die mit zahlreichen Schlagwerken wie Marimbaphon, Gong und Tamburin begleitet wird. Wir haben die Reise um die Welt in der Barockmusik im Eröffnungskonzert. Wir haben sie als Tanz, in der Filmmusik bei unserem Abschlusskonzert und dann auch noch als Fahrradkonzert.
Womit sich der Kreis schließt zu Ihrer ersten Radtour durch Potsdam.
Ja, wobei wir damals im Winter unterwegs waren. Die Idee mit dem Fahrradkonzert stammt aber nicht von uns, sondern aus dem belgischen Gent, wo das seit Jahren schon erfolgreich läuft. Damit wollen wir die Musikfestspiele für jeden öffnen. Der Musikliebhaber mag darüber die Nase rümpfen, dass wir an 22 Orten insgesamt 13 Kurzkonzerte mit Lesungen und auch Führungen durch zum Teil sonst geschlossene Räume und Häuser anbieten. Aber ich bin mir sicher, dass wir damit auch eine Sehnsucht nach der Ferne wecken.
Das Gespräch führte Dirk Becker
www.musikfestspiele-potsdam.de
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: