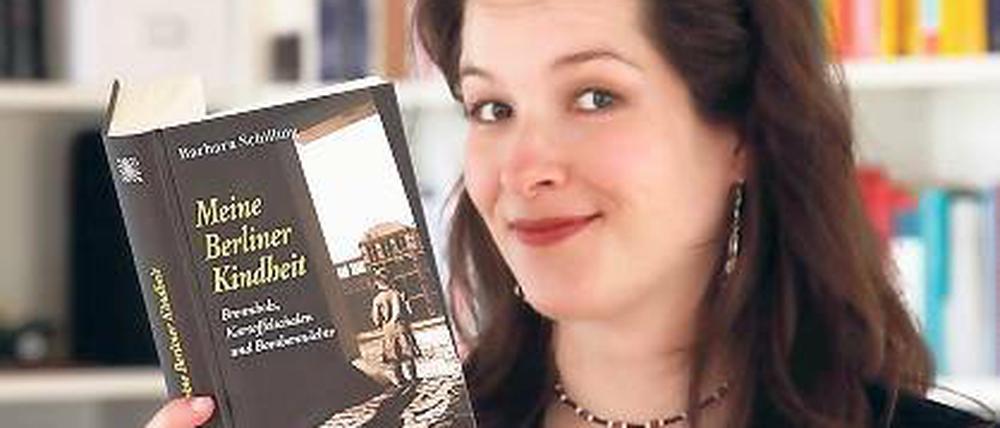
© Manfred Thomas
Kultur: Familienzusammenhalt
Die Potsdamer Autorin Barbara Schilling schrieb „Meine Berliner Kindheit“
Stand:
Als der kriechende Fahrstuhl endlich im obersten Stockwerk des hell getünchten Potsdamer Wohnhauses angekommen ist, steht eine junge Frau in der Tür und wartet schon. Sie ist Anfang 30, hat einen großen Hund, eine eigene Firma und war gerade mit ihrem ersten Roman „Meine Berliner Kindheit“ auf der Leipziger Buchmesse. Der Titel ihres Buches kann zunächst in die Irre führen, denn nicht ihre eigene Kindheit hat sie darin verarbeitet, sondern die ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Die mussten während der Kriegsjahre in den Berliner Hinterhöfen schneller erwachsen werden als Barbara Schilling. Sie hat sich von Anekdoten inspirieren lassen, die sie seit ihrer Kindheit gehört hat. Manchmal seien es aber nur ganz kleine Bruchstücke einer wahren Erzählung, die ihren Schreibfluss angestoßen hätten, sagt Schilling. Auch Schilderungen von gesprächsfreudigen Nachbarn und Kiezgrößen aus dem Berliner Bezirk Tiergarten, wo Barbara Schilling aufgewachsen ist, sind in ihren Text eingeflossen. Ihr Roman erzähle also keine wahre Geschichte. Ihre eigene Familiengeschichte sei zwar der Ausgangspunkt, dann aber habe sie sich davon gelöst und außerdem viele Stunden in Bibliotheken mit Zeitzeugenberichten verbracht, um sich in den Schauplatz ihres Romans versetzen zu können. „Ich wollte das Süß-Saure und Traurig-Schöne dieser Zeit einfangen. Ich glaube, das war eine ganz intensive Zeit“, sagt Barbara Schilling, wenn sie gefragt wird, was sie an einer Vergangenheit, die sie nicht miterlebte, so gepackt hat.
Den Roman zu schreiben, sei auch ein Identitäts-Projekt gewesen, sagt sie. Als sie anfing, daran zu schreiben, war sie Mitte zwanzig und in einer Phase, in der „man sich von den Eltern so komplett abgenabelt hat und eigentlich wieder neu annähert“, sagt Barbara Schilling. Damals hat sie neben der Arbeit am Roman und ihrer Werbeagentur an der Humboldt-Universität Berlin Kulturwissenschaft und Germanistik studiert. Trotz der Doppelbelastung habe ihr Schreiben und der Roman von dieser Zeit sehr profitiert.
Und dann habe sie da beim Schreiben noch dieses „Frauending“ entdeckt. Sonst sei sie ja nicht so eine, die unbedingt auf Geschlechterthemen versessen sei, sagt Schilling. Aber irgendwie habe sie immer wieder über diese Generation der Frauen nachdenken müssen, die im Krieg so viel geleistet haben. Aber auf einer ganz anderen Ebene als die Männer.
Auch die Heldin ihres Romans macht diese Entwicklung durch: in der Anfangsszene von „Meine Berliner Kindheit“ ist sie gerade mal drei Jahre alt. Als erstes Kind einer Minderjährigen wird sie zunächst noch von ihrer resoluten Großmutter behütet. Diese Großmutter kann trotz der so kargen Zeiten so ziemlich alles besorgen an Essbarem. Aber bald schon muss die Kleine viel Verantwortung übernehmen, um ihre kranke Mutter und die ihr folgenden fünf Geschwister durchzubringen. Familienzusammenhalt, das ist noch heute ein starkes Wort für Barbara Schilling.
Manchmal kommt ihr das eigene Leben wie Luxus vor, dann sei sie, auch wenn es etwas kitschig klinge, dankbar dafür, was sie nicht miterleben musste, wie Krieg, Hunger und die Angst. Besonders wertvoll ist ihr eine Weihnachts-Anekdote von ihrer Mutter: Die wünschte sich als kleines Mädchen einen ganzen Laib Brot für sich ganz alleine. Damals stand jedem pro Tag eigentlich nur eine Scheibe zu. „Man kann sich das heute kaum noch vorstellen“, sagt Schilling und klingt, als hätte sie schon oft versucht, das zu begreifen. Wie die Geschichte ausgeht, erfährt man auch in ihrem Roman.
Ob sie mit ihren Eltern nochmals ausführlich über diese Zeit gesprochen hätte? Barbara Schilling denkt kurz nach; es seien doch eher die lustigen Anekdoten gewesen, die sich gut hätten erzählen lassen. Die ernsten Sachen wären oft verschlossen geblieben. Auch einer der Gründe, warum sie sich dafür entschieden habe, einen Roman zu schreiben und keine autobiographische Erzählung. So konnte sie auch Szenen aus anderen Leben verwenden und ihrer eigenen Kreativität die Feder überlassen.
Einige ihrer älteren Leserinnen haben ihr bestätigt, dass es ihr gelungen sei, die Atmosphäre der damaligen Zeit, auch in den Bombenkellern, in ihrem Roman einzufangen. Das zählt für Barabara Schilling als ein großes Kompliment. Viele der Älteren seien erfreut gewesen, erzählt sie, dass sich junge Menschen mit ihrer Zeit auseinandersetzen, und zwar „nicht nur mit dieser Zeigefingermentalität“, sondern in einer Form, die auch unterhaltsam sein will und mit dem „so könnte es gewesen sein“ spielt. Undine Zimmer
Barbara Schilling: Meine Berliner Kindheit. Brennholz, Kartoffelschalen und Bombennächte, Rosenheimer Verlagshaus, 12 Euro
, ine Zimmer
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: