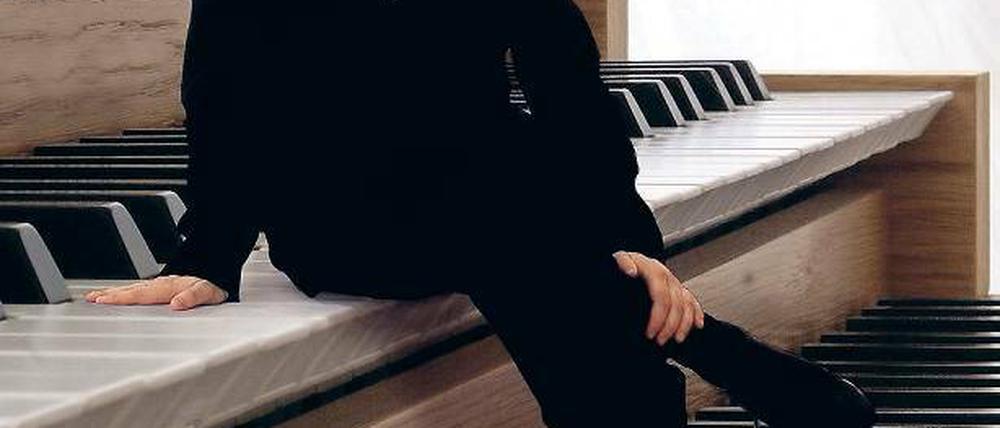
© promo
Kultur: Regers Rausch
Grandios: Der Leipziger Klangabenteurer Stefan Kießling zu Gast beim Potsdamer Orgelsommer
Stand:
„Meine Orgelsachen sind schwer“, schreibt Max Reger Ende Januar 1900 an den Kirchenmusiker Gustav Beckmann, „es gehört ein über die Technik souverän herrschender, geistvoller Spieler dazu“. Jene Spezialisten sind bis heute nicht eben häufig in der zahlreichen Organistengilde anzutreffen, die des Komponisten harmonische Überladenheit, ungebärdigen, geradezu dionysischen Ausdruckswillen nebst riesenhafter Steigerung von Lautstärke und Tempo adäquat wiedergeben können. Matthias Jacob, einstiger Kirchenmusiker an der Potsdamer Friedenskirche, dessen überzeugende Reger-Interpretationen dem Gedächtnis eingebrannt sind, gehört zu ihnen.
Nach beifallsbelohntem Orgelsommer-Auftritt an diesem Orte nunmehr dazugehörig ist auch der Leipziger Stefan Kießling, der am Mittwochabend an der Woehl-Orgel ein reines Reger-Bach-Programm vorgestellt hat. Rein instrumentenkundlich ist es für ihn sozusagen ein Heimspiel gewesen, denn als Assistenzorganist an der Thomaskirche zu Leipzig hat er als Arbeitsgerät ebenfalls eine Woehl-Orgel zur Verfügung. Dieses Vertrautsein mit den Klangdispositionen des Marburger Orgelbaumeisters hat sich hörbestens ausgezahlt.
Wie gut die Verbindung zwischen den beiden Komponisten programmdramaturgisch funktioniert, beweist sich in der eingangs gespielten Chromastischen Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903, die um 1720 in Johann Sebastian Bachs Köthener Zeit für Cembalo entstanden ist. Ein ausdrucksstarkes Bekenntniswerk bürgerlichen Selbstbewusstseins voller Sturm-und-Drang-Gebärde. Max Reger ist von diesem frei schweifenden, von Leidenschaft durchglühten, improvisatorischen Gestus fasziniert, sodass er es für Orgel bearbeitet. Der traditionsbewusste und zugleich neuschöpferische Reger kann mit diesem Stück die von ihm erstrebte Verbindung zwischen seiner eigenen Zeit und der vergangenen von Johann Sebastian Bach herstellen und Leben in die Stagnation damaliger deutscher Orgelkunst bringen.
Viele seiner Zeitgenossen finden das nicht besonders erstrebenswert. Doch der spätromantische Meister der Chromatik findet mit Bach einen Bruder im Geiste und damit ein reiches Betätigungsfeld für seine in die Zukunft weisenden Intentionen. Seine Bearbeitung verstärkt das Halbtonschrittige und die ungestümen Passagen des Originals um ein Mehrfaches. Mit vollgriffigem Spiel lässt Stefan Kießling sowohl Fantasie als auch Fuge gewaltig aufrauschen. Brausende Akkorde erklingen in gebührender Schärfe von Prinzipalstimmen, kontrastiert von filigranen Klanggebilden im Diskantbereich. Schließlich mündet alles in den finalen Rausch.
Zur Entspannung und Erbauung folgen Regers „Sechs Trios für Orgel“ op. 47, über die Karl Straube, wichtigster Propagandist des Komponisten, schreibt: „Der Pathetiker Max Reger ist hier nicht zu finden, wir atmen fast die Luft der Rokokozeit. Zierlich, niedlich, wenn es sein muss, auch drollig ist diese Musik.“ Stefan Kießling hält sich an diese Einschätzung. Er zieht hohe und hellklingende Soloregister, mit deren er es säuseln, vergnüglich hüpfen, versonnen ruhig fließen, schnarren und kapriziös eilen lässt – alles im farbenbunten Klangmix. Es folgt ein unverfälschter Bach, der sich mit der Sonate Nr. 1 Es-Dur BWV 525 als ein barocker Ideengeber für die moderne Minimal Music entpuppt. Gleichmäßig, in winzigen harmonischen Veränderungen schreitet die Musik der schnellen Ecksätze voran – heitere Spielwiesen für fröhliche Leichtigkeit. Weich getönt und schlicht erklingt das Adagio.
Zum Abschluss erklingt mit Regers gewaltiger „Fantasie und Fuge über B-A-C-H“ op. 46 die ungebärdige Hommage an den Thomaskantor, der für ihn „Anfang und Ende aller Musik“ ist. Voller Gottvertrauen stürzt sich Kießling in das anspruchsvolle Abenteuer. Es beginnt mit der vollen Dröhnung des gesamten Orgelwerks: mit donnerndem Pedal, gewitternden Diskantakkorden wie dreinfahrende Blitze. So schichten sich in Brucknerscher Manier gewaltige Klanggebirge auf. Allmählich schält sich das B-A-C-H-Thema heraus: zunächst fast ehrfurchtsvoll und zurückhaltend, dann gewinnt es an Intensität, breitet sich amöbenartig aus, wird leuchtkräftiger und strahlender, um in hymnischer Ekstase zu enden. Grandios.Peter Buske
Peter Buske
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: