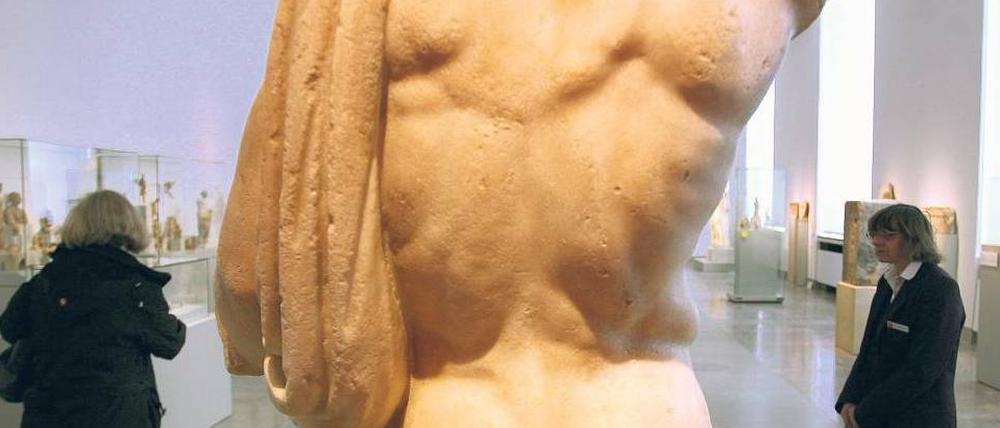
© picture alliance / dpa
Elitewettbewerb: „Gefahr für die Vielfalt der Fächer“
Unis und Elite: Wolfgang Marquardt, der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, zur Exzellenzinitiative.
Stand:
Am 15. Juni fällt zum dritten Mal die Entscheidung im Exzellenzwettbewerb. Neun Unis, die schon in den beiden ersten Durchgängen zur „Exzellenzuni“ gekürt wurden, darunter die FU, müssen ihren Status verteidigen. Sie konkurrieren mit sieben weiteren Unis, die die Vorrunde im dritten Durchgang überstanden haben: die Humboldt-Universität, Bochum, Bremen, Dresden, Köln, Mainz und Tübingen. Diese und weitere Unis ringen in dem Wettbewerb auch um „Cluster“ – große Projekte – und um Graduiertenschulen. In den kommenden fünf Jahren stellen Bund und Länder insgesamt 2,7 Milliarden Euro bereit. Tsp
Herr Marquardt, der frühere Vorsitzende der DFG, Ernst-Ludwig Winnacker, hat vorgeschlagen, den Wissenschaftsrat abzuschaffen. Er sei zu langsam und zu politisiert. Was entgegnen Sie?
Dazu haben bereits andere Stellung genommen. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Die DFG verteilt immer mehr Geld. Beeinflusst sie die Strukturen der Wissenschaft in Deutschland dadurch nicht viel stärker als der Wissenschaftsrat?
Natürlich sind Drittmittel in den letzten Jahren immer bedeutender geworden, weil die Hochschulen ihre wachsenden Aufgaben allein mit Grundmitteln nicht mehr finanzieren können. Drittmittel spielen auch bei der Leistungsbewertung von Hochschulen eine wichtige Rolle. Damit haben alle großen Forschungsförderer, nicht nur die DFG, auch einen indirekten Einfluss auf die Strukturen der Wissenschaft.
Herr Winnacker hat sich gewünscht, dass es nur zwei oder drei Exzellenzunis gibt. Darum hat er gesagt: „Mein großes Problem bei der Exzellenzinitiative war immer der Wissenschaftsrat.“ Also hat der Wissenschaftsrat darauf hingewirkt, dass die Zahl der Exzellenzunis größer wurde?

© promo
Nein. Die Exzellenzinitiative ist ein wissenschaftsgeleitetes Wettbewerbsverfahren. Kompetente Gutachter kommen auf der Basis von Sachinformationen in einem diskursiven Verfahren zur Entscheidung darüber, ob eine Universität ausgezeichnet werden soll.
Sollten die Politiker nicht wenigstens jetzt in der Schlussrunde auf eine größere regionale Ausgewogenheit achten?
Es geht in der Exzellenzinitiative um die Leistungsfähigkeit einer Universität, nicht um regionale Ausgewogenheit. Die Entscheidungen werden im Übrigen von Politik und Wissenschaft gemeinsam getroffen.
Bayerns Wissenschaftsminister Heubisch ist der Meinung, man solle keiner der jetzigen neun Exzellenzunis die rote Karte zeigen. Man könne Wissenschaft nicht mit dem Zentimeterband beurteilen. Werden Politiker also versuchen zu verhindern, dass es Absteigerinnen gibt?
Nein, das wäre ja absurd. Wir haben mit riesigem Aufwand ein aufwendiges wettbewerbliches Verfahren organisiert. Selbst wenn die Politik diesen Wettbewerb außer Kraft setzen wollte, hätte sie im Bewilligungsausschuss keine Mehrheit – sie hat dort 32 Stimmen, die Wissenschaft aber 39.
Was muss eine Exzellenzuni falsch gemacht haben, um nicht mehr weiter gefördert zu werden?
Schafft es eine Universität nicht, ein Exzellenzcluster und eine Graduiertenschule im Wettbewerb erfolgreich zu verteidigen, fehlen ihr nach den Regeln des Wettbewerbs die Voraussetzungen, weiter mit ihrem Zukunftskonzept gefördert zu werden. Ansonsten wird genau überprüft, ob sie deutliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Ziele gemacht hat. Außerdem muss ihr Fortsetzungsantrag überzeugen. Die Gutachter erwarten, dass das ursprüngliche Konzept konsequent weitergeführt und kreativ ergänzt wird.
Wissenschaftler haben kritisiert, gleiche Fälle seien im Elite-Wettbewerb nicht immer gleich behandelt worden. Warum wurde nie festgelegt, wie schwer einzelne der Kriterien gewichtet werden, um den Eindruck von Schiebereien zu vermeiden?
Man kann die Exzellenzkriterien in der Forschung nicht messen wie die Leistungen eines Sportlers im Zehnkampf. Zwar gibt es auch in der Forschung messbare Leistungsindikatoren. Sie sind aber alleine nicht repräsentativ für die Leistungsfähigkeit einer Universität. Schon gar nicht kann man aus ihnen eine aussagekräftige Rangfolge ableiten. Eine saubere Bewertung lässt sich nur über das Urteil kompetenter Gutachter erreichen, das sich auf verschiedenste Fakten stützt.
Anders als in den ersten beiden Durchläufen kommt diesmal noch das Kriterium „Lehre“ hinzu. Die Ausschreibung ist allerdings wolkig formuliert. Warum musste die Lehre jetzt noch in diesen Forschungswettbewerb aufgenommen werden?
Die Einheit von Forschung und Lehre hat in Deutschland eine lange Tradition, darum ist es nur konsequent, die forschungsbasierte Lehre mit in den Exzellenzwettbewerb aufzunehmen. Das gehört zu einer anspruchsvollen Forschungsuniversität. Gleichwohl bleibt die Exzellenzinitiative ein Programm der Forschungsförderung.
Wie ist es zu rechtfertigen, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler im Exzellenzwettbewerb weit weniger Chancen haben als Natur- und Technikwissenschaftler?
Diese Annahme ist nach meinem Wissen empirisch nicht belegbar.
Nur vier von den 27 jetzt ins Finale gelangten Clustern kommen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, bei den bereits geförderten 37 Clustern sind es sechs. Dabei kamen aus diesen Gebieten so viele Anträge wie aus den Natur- und Technikwissenschaften.
Dem würde ich keine Beachtung schenken, denn das ist ja nicht das Ergebnis einer Quotierung, sondern eines Wettbewerbs. Außerdem sind die Kulturwissenschaften in der Exzellenzinitiative erfolgreicher gewesen als in den koordinierten Programmen der DFG. Die Kulturwissenschaften stehen auch im internationalen Vergleich bei der Förderung gut da. Sie zeigen sehr gute Leistungen und haben es darum gar nicht nötig, in der Exzellenzinitiative eine besondere Schutzzone eingerichtet zu bekommen.
In fünf Jahren laufen die Mittel aus dem Exzellenzwettbewerb aus. Dann fehlen den beteiligten Universitäten 540 Millionen Euro jährlich. Wie wird diese riesige Finanzlücke gestopft werden?
Um die Mittel im System zu halten, braucht man gute Ideen, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Eine Arbeitsgruppe im Wissenschaftsrat arbeitet daran. Eine Fortsetzung des Wettbewerbs, die weiterhin allein auf die Spitzenforschung ausgerichtet wäre, würde zu kurz greifen. Man muss in Zukunft auch andere Leistungsdimensionen des Wissenschaftssystems in den Blick nehmen, wie die Lehre oder den Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung.
Der Bund will eine Verfassungsreform, die Kooperationen zwischen außeruniversitären Instituten und Hochschulen erleichtert. Aber damit könnte doch nicht drei Dutzend Universitäten geholfen werden, die zig Millionen Euro aus dem Exzellenzwettbewerb verstetigen müssen?
In der Tat geht es um mehr als darum, diese Kooperationen an einigen wenigen Standorten zu finanzieren. Vielmehr soll die Verfassungsreform es dem Bund ermöglichen, dort Universitäten institutionell mitzufinanzieren, wo es funktional sinnvoll ist. Wir müssen die Wissenschaftsförderung insgesamt als nationale Aufgabe begreifen.
Manche Wissenschaftler fürchten sich geradezu davor, dass ihre Uni in der Exzellenzinitiative siegt. Der bürokratische Aufwand werde die Forschung behindern. Vor allem sei die Fächervielfalt bedroht, wenn Dutzende von Cluster-Professuren später auch mit Bordmitteln verstetigt werden müssen. War der Exzellenzwettbewerb vielleicht doch keine so gute Idee?
Der bürokratische Aufwand liegt in der Exzellenzinitiative ganz sicher unterhalb dessen, was bei EU-Anträgen notwendig ist. Natürlich standen die Wissenschaftler aber unter Druck, in kurzer Zeit umfangreiche und zukunftsweisende, meist interdisziplinäre Anträge zu erarbeiten. Viele neue Kooperationen sind dabei entstanden. Allerdings brauchen wir nach dieser dynamischen Wettbewerbsphase nun auch wieder eine Phase der Ruhe, in der das Begonnene konsolidiert werden kann. Die Gefahr, dass die Fächervielfalt an Unis mit vielen Clustern reduziert werden könnte, wenn tatsächlich die zusätzlichen Mittel der Exzellenzinitiative ab 2018 ersatzlos entfallen, sehe ich durchaus. Auch deshalb ist es wichtig, dass Nachfolgeprogramme rechtzeitig geplant werden. Universitäten dürfen nicht gezwungen sein, die entstandenen Perlen an außeruniversitäre Einrichtungen abzugeben, weil sie nicht mehr dafür aufkommen können. Das würde die Idee der Exzellenzinitiative, die Universitäten zu stärken, geradezu konterkarieren.
Die Fragen stellte Anja Kühne.
WOLFGANG MARQUARDT, 56, ist Professor für Prozesstechnik an der RWTH Aachen und seit Anfang 2011 Vorsitzender des Wissenschaftsrats
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: