
© imago/Christian Mang
Das liegt mir auf der Seele: Zehn Jahre, zehn Empfehlungen zur Flüchtlingskrise
Unsere Redakteurin beschäftigt sich seit einem Jahrzehnt mit Flucht – auch privat. Was sich ihrer Meinung nach ändern muss, damit es kein „die“ und „wir“ mehr gibt.
Stand:
Zahlen und Fakten sind das eine, die Menschen dahinter das andere. Deswegen zieht es mich seit zehn Jahren dorthin, wo die Schlauchboote ankommen, in Berlins Heime und Unterkünfte, zu den Kindern, Jugendlichen und Familien. Ich wollte aber nicht nur darüber schreiben, ich wollte als Bürgerin selbst etwas tun. Neun Jahre lang war ich leidenschaftlich und erfolgreich Pflegemutter eines ehemals geflüchteten Kindes, doch mein Familienleben bleibt privat.
Seit 2015 habe ich an vielen Orten Antworten auf die Fragen unserer Zeit gefunden wie diese: Was trennt uns und was haben wir gemeinsam? Wie können unterschiedliche Welten zueinander passen? Was läuft schief bei der Integration und wo hat sie geklappt? Warum muss man Sorgen, Ängste und Kritik in Politik und Gesellschaft ernst nehmen? Und wie kann man ihnen entgegenwirken?
Hier sind zehn Empfehlungen nach zehn Jahren, die ich als Kritikerin des Flüchtlings- und Integrationswesens im Jubiläumsjahr loswerden muss.
1. Motivation nicht verpuffen lassen

© Annette Kögel
Wie viel Funkeln habe ich seit 2015 in den Augen vieler Menschen gesehen, die gerade angekommen waren. Und sie sagten: Wir wollen Deutschland danken, etwas zurückgeben, arbeiten! Bei den Teenagern aus Afrika, die die lebensgefährliche Flucht für eine bessere Zukunft bewältigten, spürte ich Leidenschaft, Energie und Sehnsucht nach Zukunft. Von ihnen hörte ich: Ich will Kfz-Mechaniker werden, IT-Spezialist, Arzt, Anwältin, Journalistin!
In Deutschland kamen so viele dieser willigen Menschen an, dass die Politik, die Behörden, wir alle, überfordert waren, und es vielfach weiter sind. In Berlins Ämtern machten engagierte Mitarbeitende Überstunden, doch sie kamen einfach nicht hinterher. Zahllose Vorschriften machten es nicht leichter. Der als Handwerker erfahrene Afghane, der das undichte Dach der Schule reparieren wollte, in der er untergebracht war, durfte nicht. Die Teenager, die auf Gran Canaria oder Lesbos noch davon schwärmten, wie stolz sie ihre Familien zu Hause machen wollten, wurden ausgebremst. Monatelang war wegen des Riesenandrangs in Berlin kein Schulplatz zu finden. Die Asylverfahren zogen sich über Jahre. Derweil saßen Jugendliche aufgrund von Personalmangel zeitweise ohne Betreuer passiv und depressiv in ihrer Unterkunft.
Dass die Bundesrepublik alles mehrstufig bürokratisch absichert, macht mit Blick auf die deutsche Geschichte Sinn. In der heutigen globalisierten Welt sollten wir Regeln jedoch anpassen und unkonventionell handeln, damit die Motivation von Geflüchteten sich zu integrieren und zu arbeiten nicht verpufft.
2. Formulare, Vordrucke, Bescheide
Flüchtlinge haben viel mit Behörden zu tun. Nichts geht ohne Stapel von Papieren. Aber die Amtssprache! Formulare, Vordrucke, Bescheide versteht mitunter kaum ein hier geborener Deutscher. Das geht verständlicher und zeitsparender, für beide Seiten.
3. Weniger staatliche Unterstützung für mehr eigenes Zutun
Ich habe noch den jungen Mann aus Pakistan vor Augen, der mir 2015 in Alt-Moabit in der Schlange vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) freudig ein Formblatt entgegenhielt. „Diese Summe wird mir ausgezahlt“, sagte er, „so viel bekomme ich daheim in Jahren nicht!“ Geflüchtete Familien in Berlin wissen aus den Schreiben der Jobcenter, wie viel Bürgergeld und weitere Leistungen ihnen im Monat selbst zustehen und wie viel Geld darüber hinaus jeden Monat an Betreiber von Unterkünften überwiesen wird. Es sind hohe Beträge, oft Tausende Euro.

© dpa/Julian Stratenschulte
So ergibt sich aus Perspektive vieler Geflüchteter oft der Eindruck, dass sich Arbeit in Niedriglohnjobs finanziell nicht lohnt. Nach den vielen Jahren ohne Frist nach hinten, in denen das Leben ohne eigene Arbeit finanziert wird, haben sich einige an die unbefristete Unterstützung durch das Jobcenter wie eine selbstverständlich zustehende Zahlung gewöhnt.
Geflüchtete haben dann die Befürchtung, das Leben mit einem Mini-Einkommen nicht finanzieren zu können. Sie müssten dann selbst dafür aufkommen, was bei Bürgergeldempfängern der Staat übernimmt: Miete und Heizung, Krankenversicherung, Rentenbeiträge, Einrichtungspauschalen, Schulkosten und weitere Leistungen. Dabei können auch Geringverdiener zahlreiche Leistungen wie Wohngeld oder das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr beantragen.
Doch trotz inzwischen höherer Zuverdienstmöglichkeiten für Berufseinsteiger auch bei Förderung durch das Jobcenter, bin ich überzeugt davon, dass Integration besser funktionieren würde, wenn Bürgergeldleistungen nur als Anschubfinanzierung zeitlich begrenzt gewährt und über die Jahre gesenkt würden. Der Vorschlag zweier Thüringer SPD-Landräte, Jobcenterleistungen künftig wie Bafög als Darlehen zu gewähren, sollte ebenfalls nicht verworfen werden. Es sind aber nur Teilrückzahlungen realistisch, denn in ein paar Jahren kommen für eine vom Bürgergeld lebende Familie schnell sechsstellige Beträge zusammen. Wer körperlich oder seelisch nicht arbeitsfähig ist, braucht natürlich weiter besondere Hilfen. Generell haben sich Vermittlung in sozial-gesellschaftliche Tätigkeiten bewährt, sie fördern Selbstwirksamkeit und führen in eine Tagesstruktur zurück.
4. Mut zur Lücke
So wie einerseits Einheimische auf Geflüchtete schimpfen und rechte Parteien mit der „staatlichen Hängematte“ Stimmen holen, so schütteln Geflüchtete oft über deutsche Vorschriften den Kopf. Berlin kennt die Klagen über bremsende Genehmigungsvorgänge von Bau- oder Start-Up-Unternehmern. Geflüchtete wiederum verzweifeln am System der Anerkennung von Qualifikationen, das sie als langwierig und festgefahren empfinden. Geforderte Zeugnisse oder Zertifikate können sie teils nicht vorweisen, weil es diese im alten Heimatland gar nicht gibt.

© Annette Kögel
Natürlich, es braucht auch Nachschulungen, zum Beispiel war körperliche Züchtigung in syrischen Schulen üblich. Doch der Mechaniker aus Kamerun könnte in einer Autowerkstatt sicherlich hilfreiche Dienste leisten. Es muss für den Einstieg endlich mehr Praktika und Learning by Doing unter fachlicher Aufsicht geben.
5. Fremd und doch so ähnlich
Nie vergessen werde ich den Anblick des Afghanen im früheren Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos, der am selbst ausgehobenen Erdofen hockend Essen zubereitete. Das mutete archaisch an. Wie wird er mit einem Leben in Deutschland klarkommen, und was bedeutet es für uns, wenn mehr so geprägte Menschen wie er in Berlin leben?

© Annette Kögel
Viele Geflüchtete waren 2015 mit unserem Lebensstandard nicht vertraut: Einige, die in ihrer Heimat auf dem Land lebten, trauten sich anfangs nicht, in Berlin ein Toilettenbecken zu benutzen, weil sie befürchteten, kostbares Trinkwasser zu verunreinigen. Die Öffentlichkeit lästerte: Sind die asozial, die entleeren sich neben dem WC auf dem Boden.
Das zum Thema Vorurteile. Doch längst sind gerade afghanischstämmige Geflüchtete geschätzte und liebgewonnene, hoch qualifizierte Arbeitskräfte in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Sie haben fehlende Schulbildung, durch die Zustände in Afghanistan und im Iran, aufgeholt.
Mädchen nutzten ihre Chance auf Freiheit und Gleichberechtigung und haben Karriere gemacht. Bevor die Taliban die Macht übernahmen, wurden Afghanen, anders als Syrer, in Berlin nur geduldet. Viele strebten daher ein Bleiberecht über Arbeit an. Ich kenne ehemalige Afghanen, inzwischen von ihren Pflegeeltern adoptierte Deutsche, die studieren oder eine eigene Firma gegründet haben. Sie sind einfach tolle Menschen.

© privat
Auch deswegen mache ich gerne Mut, offener zu sein. Frauen mit Kopftuch sind auch nicht anders als jene ohne Kopftuch, sympathisch oder unsympathisch, selbstbewusst oder schüchtern.
6. Geht doch!
Zehn Jahre nach 2015 jedoch scheint Deutschland gespalten. Die einen gehören zum Team „Refugees Welcome“ ohne jegliche Einschränkungen, die anderen verfolgen die Linie „Weist alle aus“. Weder das eine noch das andere ist die Lösung. Die Realität ist nicht so polarisiert, wie Social Media und einige Medien sie vermitteln. Das liegt, Hand aufs Herz, teils an selektiver Wahrnehmung. Man kennt es von sich selbst: Skandale und Dramen nehmen wir oft eher wahr als das, was still und leise klappt.
Mein Appell geht an uns Medienmenschen, an den Senat, Bezirke, Unternehmen, Tourismusverbände, Kammern, Vereine, Nachbarschaften: Stellen wir mehr Best-Practice-Beispiele heraus! Wir müssen zeigen, wo und wie das neue Miteinander gelingt, denn das bestätigt, motiviert und beseitigt Berührungsängste. Viele Pflegeheime, Kliniken, Securitydienste müssten ohne Personal mit Migrationshintergrund dicht machen.

© IMAGO/Thomas Goedde
Nicht zu vergessen: Erfolgreiche Geflüchtete haben mit viel schlechteren Ausgangsbedingungen – Heimatverlust, Kriegs- und Fluchterfahrung, beengten Wohnverhältnissen – im Vergleich so viel mehr geleistet und geschafft als die meisten von uns, die wir hier geboren wurden und sozialisiert sind.
7. Keine falsche Zurückhaltung
Doch wenn etwas nicht klappt oder einen ärgert, darf es auch keine falsche Zurückhaltung geben. Pragmatiker wie Boris Palmer kritisieren zehn Jahre nach 2015, dass aus politischer Korrektheit zu viel hingenommen wurde, was man Nicht-Geflüchteten längst gespiegelt hätte. Das muss natürlich sachlich geschehen. Ein Beispiel: Ich habe oft gehört, dass Schulkinder für ihre Mütter übersetzen, weil diese auch nach Jahren kaum Deutsch sprechen. Auch beim Frauenarzt.
Ich wünsche mir Beschäftigte in der Praxis, die sagen, liebe Patientin, wenn es um ihre gynäkologischen Probleme geht, kommen Sie bitte mit einer erwachsenen Übersetzerin, das ist nichts für Sohn oder Tochter, außerdem haben wir die Schulpflicht. Sie müssen schon bitte selbst Deutsch lernen!
Mit verstärkten Grenzkontrollen, die Pendlern an der deutsch-polnischen Grenze das Leben schwer machen, ist es für mich nicht getan. Viele Schlepper fahren jetzt einfach andere Wege, oder Flüchtlinge kommen mit gefälschtem oder angeblich verlorenen Pass von Menschen, denen sie ähnlich sehen, per Flugzeug. Warum werden den Ermittlern gegen Schlepperbanden, die für ihre Profite über Leichen gehen, nicht effektive Fahndungsinstrumente zugestanden? Wenn Online-Bezahlsysteme besser überwacht und Geldflüsse gekappt würden, wäre ihr Geschäftsmodell hinfällig.
8. Deutscher als Deutsche
Menschen, die von weither aus Krieg, Krise oder Armut kamen, sind teils deutscher als Deutsche, pünktlicher und strukturierter als die Autorin dieser Zeilen. Mein erster im Privatleben ehrenamtlich betreuter Schützling war ein unbegleiteter Minderjähriger aus Afrika. Wie ordentlich er seinen Bereich im Mehrbettzimmer-Hostel hielt, sein Paar Schuhe millimetergenau aufgestellt.
Bitte niemals Vorurteile wegen des Aussehens oder der Religion! Man kann sich mit Muslimen durchaus über Glaubensfragen austauschen oder auch mal streiten, ohne sich zu entzweien. Klarzumachen, dass Religion in Berlin nicht so eine große Rolle spielt, auch das ist Integration.
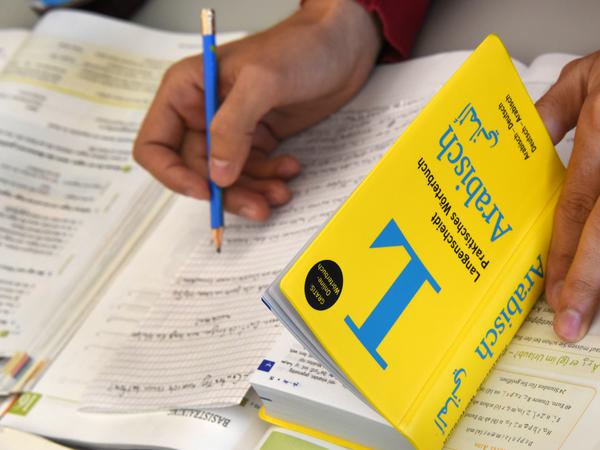
© picture alliance/Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild
Ich kenne ehrgeizige junge Geflüchtete, die fließend Deutsch oder Englisch sprechen, die arbeiten und studieren und mehr Geld verdienen werden als ich. Es ärgert mich, dass manche sie mit Geringschätzung als Flüchtlinge bezeichnen, obwohl sie längst angekommen sind. Sie gehören zu uns.
9. Von Mensch zu Mensch
Ob Fußball-Sommermärchen oder die euphorische Zeit der Willkommenskultur, nichts hält für ewig. Dennoch: Bleiben wir dran. Ich möchte meine Begegnungen mit einst Geflüchteten, die nicht weniger bürgerlich und gebildet sind als hier Geborene, nicht missen. Sie haben mich ein Jahrzehnt lang ungemein bereichert, mit unbändigem Willen, und auch mit viel Humor.
Um solche Begegnungen zehn Jahre nach 2015 anzuschieben, braucht Berlin wieder mehr offiziell ausgelobtes Mentoring und Patenschaften.
Ob bei den Eltern in Kita oder Schule, zwischen Arbeitskollegen oder unter Nachbarn: Auch die Politik sollte Begegnungen überall aktiv fördern.
10 Die Welt geht nicht unter
Zum Schluss möchte ich Sie eines fragen: Wer von uns würde in einer Notsituation nicht nach einem Ausweg suchen, möglichst in einem Land, in dem es bessere Zukunftschancen gibt als in der Heimat? Ich selbst habe schon darüber nachgedacht, wohin ich flüchten würde, wenn sich der Ukraine-Krieg ausweiten sollte. Aber ich hoffe, wie immer, auf das Beste.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- false