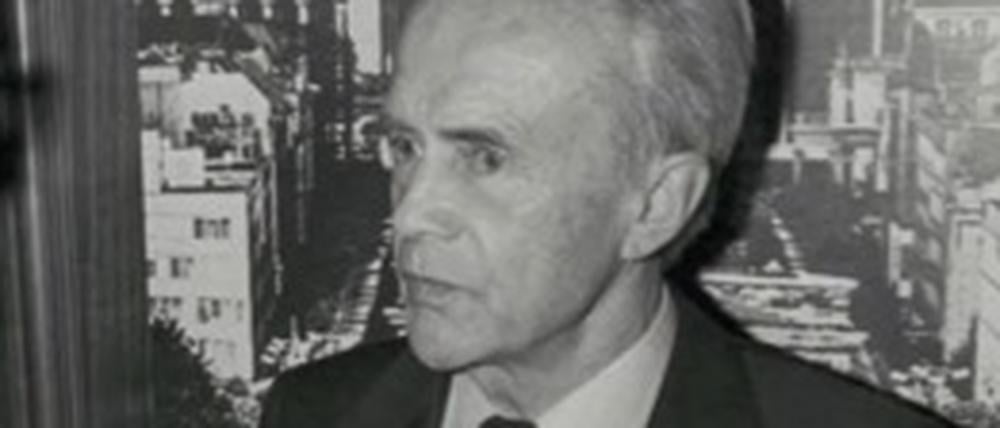
© Tsp-Archiv
„Nicht manipulierbar“: Der letzte Artikel von Günter Matthes für den Tagesspiegel
Kurz vor seinem Tod vor 30 Jahren hatte der langjährige, stadtprägende Kolumnist der Redaktion diesen Text für die Rubrik „Sprachlabor“ gesandt, der dann neben seinem Nachruf im Berlin-Teil erschien.
Stand:
Eine Krisensitzung der Berliner SPD nach dem Wahldebakel. In dem Bericht heißt es, Manfred Stolpe habe Verständnis dafür geäußert, daß die Berliner Genossen erst einmal „Trauerarbeit leisten“ müßten. Der Leser stutzt. Trauer? Ist solche Bezeichnung des Verwindens politischer Niederlagen nicht zu hoch gegriffen? Das umflorte Wort wird schließlich nicht mit schwarzem Humor verfremdet, wie es der Volksmund beim „Trauerkloß“ tut.
Und Arbeit? Trauer wird nicht geleistet, sondern empfunden. Arbeit macht Mühe. Wer sich Mühe geben muß, um Trauer zu empfinden, trauert nicht. So haben Margarete und Alexander Mitscherlich bei der Auseinandersetzung mit unserem heiklen Verhältnis zum Völkermord auch nicht eine Trauerarbeitsscheu oder gar Trauerarbeitslosigkeit beklagt, sondern die „Unfähigkeit zu trauern“.
„Trauerarbeit“ ist ein neudeutsches Unwort. Kein Nachschlagewerk hielt es früher feil. In keine Fremdsprache ist es übersetzt, geschweige denn original übernommen wie der Kindergarten, der Blitzkrieg oder das Waldsterben. Der neue Duden hält es mit dem Hinweis auf „Psychologie“ immerhin für erläuterungsbedürftig. Das klingt nach Wissenschaft, sollte uns aber zumal in der Trauerwoche nicht daran hindern, dieses widersinnig wie auch das teutonische „Arbeitsessen“ gebildete Wort zu diskutieren, was wörtlich „zerteilen“ heißt.
Die Koppelung hat etwas mit unserer Mentalität, unserer Tüchtigkeit zu tun. Wir meinen, alles auf- und abarbeiten zu können. Indes unterbrechen wir traditionell und, konventionell unsere Arbeit durch Schweigeminuten, durch Innehalten, um Trauer gemeinsam in Untätigkeit zu bekunden. Befällt nicht auch Zeitgenossen mit der Fähigkeit zu trauern ein Widerwille, daß unser gabenbringendes Weihnachtsfest schon lange vor den einst respektierten Trauerfeiertagen umsatzträchtig vermarktet wird?
Wer der Trauer wegen tatsächlich Arbeit zu leisten hat, seien es Geistliche, Psychologen oder Organisationen und Angehörige Verstorbener bei der Grabpflege, tut es, um zur inneren Bereitschaft und einem würdigen Rahmen beizutragen. Die Trauer selbst legt die Hände in den Schoß oder faltet sie. Sie bewegt das Gemüt auch über den Schmerz und die Anteilnahme hinaus. Die Trauer ist eine unwillkürliche Hinwendung zu dem, was höher ist denn alle Vernunft, und selbst für den Agnostiker, den in kirchlichem Sinne nicht Gläubigen, wie ein Gebet.
Der uralte Imperativ: Bete und arbeite! belegt durch die auffordernde Verbindung der Begriffe deren Ausschließlichkeit. Wer Trauer als Arbeit mißversteht, verwechselt materialistisch Freuds „Über-Ich“ und Marxens „Überbau“ mit dem uns Menschen eingeborenen, genetisch nicht manipulierbaren Bedürfnis nach Transzendenz - ob wir es himmelhoch jauchzend empfinden oder zu Tode betrübt. -thes
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: