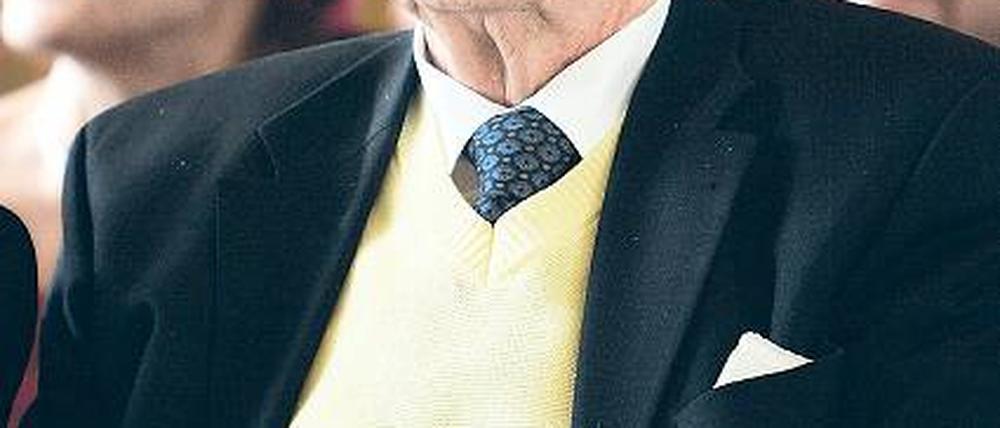
© dpa
Politik: Zwei Völker haben zueinandergefunden
Zum 20. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags / Von Hans-Dietrich Genscher
Stand:
Am 21. Juni 2011 werden in Warschau die Regierungen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame Kabinettsitzung abhalten. Anlass ist die zwanzigste Wiederkehr der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages vom 17. Juni 1991. Die Bilanz wird positiv sein. Die Perspektiven sind es auch. Indessen wäre es zu wenig, sich mit diesen Feststellungen zu begnügen.
Nach einer wechselvollen Geschichte, nach guten und nach schlechten Zeiten und nach Perioden unvergesslichen Schreckens haben unsere Völker mit dem Willen zur Freiheit zueinandergefunden. Vorausgehen musste das Bekenntnis zu historischer Verantwortung und zu den Konsequenzen aus dieser Erkenntnis. Der Kniefall Willy Brandts in Warschau war eine einmalige Geste nach einem einmaligen Verbrechen an einem Nachbarvolk der Deutschen. Dieser Kniefall und seine moralischen und historischen Konsequenzen machten den Weg frei für einen neuen Anfang zwischen Polen und Deutschen. Der Warschauer Vertrag von 1970 war dafür ein unverzichtbarer Schritt. Er öffnete auch den Weg für die Vereinbarung der Schlussakte von Helsinki, die die Voraussetzungen schuf für einen breit angelegten Entspannungsprozess zwischen West und Ost und für einen sich immer mehr beschleunigenden Evolutionsprozess im sowjetischen Machtbereich, der in der Perestroika- und Glasnost-Politik Gorbatschows seinen Höhepunkt fand. Es war ein symbolischer Akt, dass die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki am 1. August 1975 zusammenfiel mit der Vereinbarung der zweiten Polenverträge. Sie fanden ihren Abschluss 1976.
Die Kirchen der beiden christlichen Konfessionen wurden zu Brückenbauern zwischen Polen und Deutschen. Sie drückten aus, was das Verhältnis auf beiden Seiten belastete, und sie machten möglich, dass dennoch der Weg der Völker zueinander von beiden Seiten beschritten wurde. „Wir vergeben und wir bitten um Vergebung.“ Es ist nur ganz selten in meinem Leben geschehen, dass mich ein Wort so angerührt hat. Ich habe damals gehofft, dass jeder in Deutschland verstand, dass es so nur von polnischer Seite gesagt werden konnte.
Nirgends fand Solidarnosc so viel Widerhall wie in Deutschland – unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in Ost und in West unseres Landes. Nirgends gab es so viel Hilfsbereitschaft und vielleicht wurde nirgends so unmittelbar empfunden wie bei uns, was in jenen Jahren zwei große polnische Persönlichkeiten für die Zukunft Europas bewirkten: der Papst Johannes Paul II. und der polnische Arbeiterführer Lech Walesa. 1989, im Jahr der großen europäischen Freiheitsrevolution, waren sich nicht nur Polen und Deutsche, sondern die Europäer überall so nahe in ihren Wünschen, ihren Hoffnungen und auch ihren Besorgnissen wie niemals zuvor in der europäischen Geschichte. Das ist das Vermächtnis jener Zeit. Das stand auch vor meinen Augen, als ich am 14. November 1990 den deutsch-polnischen Grenzvertrag unterzeichnete. Vorausgegangen war meine Erklärung vor der 44. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 27. September 1989, sechs Wochen vor dem Fall der Mauer:
„Ich wende mich an Sie, Herr Außenminister des neuen Polens, ... das polnische Volk ist vor 50 Jahren das erste Opfer des von Hitler-Deutschland vom Zaun gebrochenen Krieges geworden. Es soll wissen, dass sein Recht, in sicheren Grenzen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche infrage gestellt wird. Das Rad der Geschichte wird nicht zurückgedreht. Wir wollen mit Polen für ein besseres Europa der Zukunft arbeiten. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist Grundlage des friedlichen Zusammenlebens in Europa. ...“
Der deutsch-polnische Vertrag vom 17. Juni 1991 muss verstanden werden als die Grundlage einer neuen Verantwortungspolitik unserer beiden Völker. Das Vermächtnis der europäischen Freiheitsrevolution von 1989/90 erlegt Polen und Deutschen eine besondere Verantwortung auf. Eine Verantwortung, die sie, aufgrund der Geschichte, gemeinsam mit Frankreich tragen. Das ist die historische und moralische Begründung des Weimarer Dreiecks. Die Zusammenarbeit des Landes in der Mitte, des europäischen Deutschlands – wie Thomas Mann es nannte – mit seinen beiden großen Nachbarn in Ost und West, Polen und Frankreich, trägt.
Das gibt Anlass genug, sich dieser Verantwortung gerade jetzt bewusst zu werden. Was nationale Verblendung bewirken kann, haben unsere Völker immer wieder erfahren müssen. Gerade jetzt, da sich unser Europa in schwerer See befindet, brauchen wir das gemeinsame Denken und das übereinstimmende Handeln dieser für das Schicksal Europas so bedeutsamen Völker. Wenn wir also den 20. Jahrestag des deutsch-polnischen Vertrages begehen, dann sollten wir uns der historischen Bedeutung in all ihren Dimensionen bewusst sein. Europa, das sich vor 20 Jahren mit dem Willen zu Freiheit und Demokratie neu verbunden hat, erlebt in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, wie auch dort die Völker für ihre Freiheit eintreten. Europa, das aus der Geschichte gelernt hat, kann bei der Gestaltung einer neuen Weltordnung ein Beispiel geben dafür, dass die Anerkennung von Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit der kleineren und der größeren Völker Frieden und gemeinsamen Fortschritt möglich macht. Politik verlangt tägliche Entscheidungskraft und Führungsverantwortung. Sie verlangt aber heute zuallererst das Bewusstsein, dass in einer neuen Weltordnung der Interdependenz Frieden und Stabilität nur gesichert werden können, wenn eine solche Weltordnung überall als gerecht empfunden werden kann. Unsere Völker sind durch Höhen und Tiefen in der europäischen Geschichte gegangen. Daraus ist ihnen die Kraft erwachsen, für immer zueinander- zufinden – in Freiheit.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: