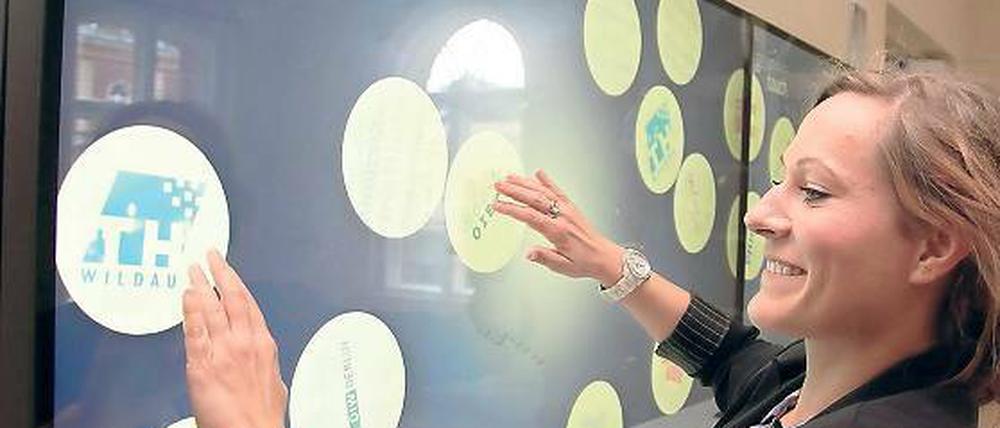
© Manfred Thomas
Homepage: Brisante Kulturrevolution
An der Universität Potsdam machen sich zurzeit Wissenschaftler Gedanken über die kulturellen Folgen der Neuen Medien
Stand:
Das Paradies verlange den Überwachungsstaat. So drastisch formuliert Professor Hans-Joachim Petsche vom Institut für Philosophie der Uni Potsdam seinen Blick auf die Entwicklung des Internets. Gemeint ist damit, dass die technischen Möglichkeiten, Konsumverhalten und die Wünsche von Internetnutzern zu generieren, letztlich auf so etwas wie den gläsernen Menschen hinauslaufen würden. So ärgert es den Professor zum Beispiel, dass Verlage ihm nur noch Bücher zu den gleichen Themen schicken. Weil die Algorithmen spezieller Softwareprogramme seiner Person diese Interessen zuschreiben. Dabei interessiere er sich doch auch für ganz andere Dinge. Immerhin: So gläsern, dass die Rechner auch seine offensichtlich verborgenen Interessen kennen, ist der Internetnutzer noch nicht.
Für Petsche liegt die Betonung dabei eher auf dem „noch nicht“. „Wir befinden uns erst am Anfang der Reise, schwer zu sagen, wo sie hinführt“, sagte der Philosophieprofessor auf der interdisziplinären Tagung zur Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume in den Neuen Medien. Bis zum heutigen Mittwoch diskutieren die Wissenschaftler aus acht Ländern das Thema an der Potsdamer Uni, organisiert wurde das Treffen von Uni-Professor Petsche zusammen mit dem Philosophieprofessor Andrzej Kiepas von der Schlesischen Universität Katowice.
Die Ausgangsfrage der Jahrestagung des internationalen „Cultmedia-Netzwerkes“, ob kulturelle Räume durch die neuen Medien verödet oder bereichert werden, war kaum einheitlich zu beantworten. Für beide Entwicklungen sehen Wissenschaftler Anzeichen. Immerhin, gab Malgorzata Bogaczyk-Vormayr (Poznan/Salzburg) zu bedenken, habe das Erzählen im Internet mit dem Kern der Narration zu tun: „mit der Sprache selbst, mit ihrer schöpferischen darstellenden Kraft“. Wobei das Erzählen zunehmend aber auch über Bilder und Videos stattfindet. Julius Erdmann von der Uni Potsdam hat dazu die These aufgestellt, dass die visuellen Darstellungen im Netz zur Entfaltung der Individualität ihrer Nutzer dienen: Bildzeichen werden demnach zur Selbstfindung und Selbstgestaltung des Individuums genutzt.
Das veränderte Kommunikationsverhalten in den Neuen Medien kommt für Urszula Zydek-Bednarczuk (Katowice) gar einer Kulturrevolution gleich. Bei der Kommunikation in sozialen Netzwerken ließen sich weitgehende Änderungen der Funktion, des Inhalts wie auch der Aussageform im Vergleich zu herkömmlichen Gesprächen feststellen. Der dezentralisierte Charakter der Verständigung untermauere zudem das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer globalen Gemeinschaft der Netznutzer. Die polnische Kommunikationsforscherin spricht von der Entstehung einer „globalhood“.
Der Potsdamer Philosoph Petsche sieht die Entwicklung kritischer. Virtualisierung als Inszenierung des „als ob“-Effektes sei zwar kein neuzeitliches Phänomen. Manche seiner Kollegen betrachten bereits Platons Höhlengleichnis als die erste philosophische Beschreibung von Virtualität. Heute sieht Petsche in dem Phänomen der Virtualität aufgrund von Globalisierung und technischer Perfektionierung aber zunehmend bedrohliche Züge. Es sei ein Fehler, das Internet immer noch als Kommunikationsmedium zu sehen. „Mittlerweile ist es viel mehr“, so Petsche. Es greife handlungsmächtig und gestaltend in die Geschehnisse ein. Das Netz sei heute auch ein Handlungsmedium, in dem Menschen miteinander operieren und Handlungen auslösen – wie etwa einen militärischen Angriff aus der Ferne. „Das Internet ist heute eine Verzahnung und Verflechtung von materieller mit geistiger Aktion.“
Die Bedrohung, die Petsche sieht, lauere unter der sichtbaren Oberfläche des Netzes. „Was wir sehen ist nicht das, was passiert.“ Besondere Sorge mache ihm, dass Staaten aus Sicherheitsgründen im Internet einen Kontrollwahn entwickeln könnten.
Andererseits hält Petsche das Phänomen der Neuen Medien – abgesehen von Auswüchsen wie dem NSA-Skandal, Gewaltverherrlichungen oder ähnlichem – in ihrer Bedeutung für überbewertet. „Wären sie wirklich so bedeutsam, wäre die Welt schon wesentlich stärker durcheinander.“ Dass nun beispielsweise auf dem Münchner Oktoberfest viele junge Menschen in Trachten zusammenkämen, sei genau das Gegenteil von Virtualität. Petsche nennt auch eine Untersuchung, wonach Mobiltelefone das heutige Leben wesentlich weniger verändert hätten als bislang angenommen.
Die künftigen Generationen werden es ohnehin anders machen als erwartet, so Petsches Fazit. Und er zitiert vielsagend Bertolt Brecht: „Soll es ein andrer Mensch sein? Oder eine andre Welt? Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!“ Jan Kixmüller
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: