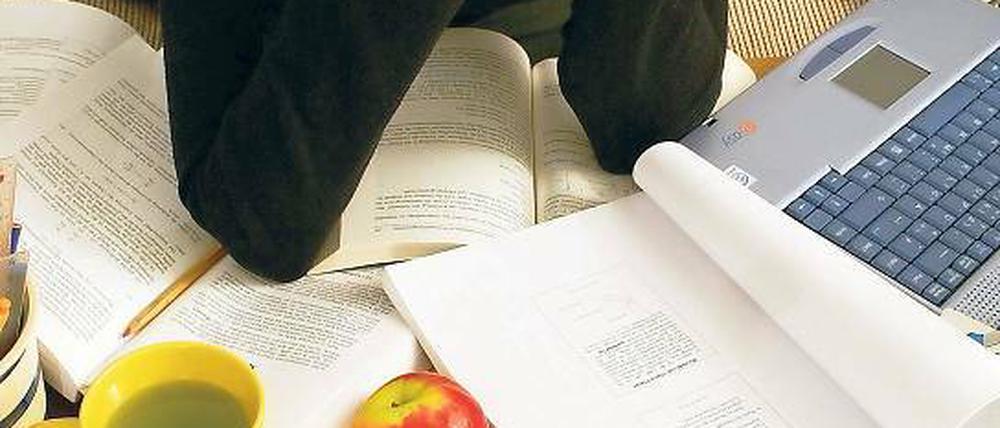
© dpa
Landeshauptstadt: Das Schuljahres-ABC
An den Schulen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark ist die Kreidezeit noch lange nicht beendet. Und es gibt eine Schule, an der Schülern „nichts beigebracht wird“ und „Lehrer nicht ungefragt Wissen vermitteln“. Weil Ratgeber seit Jahren beliebt sind, gibt es an dieser Stelle eine Anleitung für das laufende Schuljahr
Stand:
Abitur. Es sind die letzten Monate vor der großen Freiheit, doch erst kommt die Prüfungsangst: Der letzte Schultag für Abiturienten ist am 29. März 2012, die ersten schriftlichen Prüfungen beginnen am Tag darauf und enden am 4. Mai. Es folgen mündliche Prüfungen, Nachprüfungen und die Zeugnisausgabe. Erst dann ist es geschafft. Der Jahrgang ist etwas besonderes. Gab es im Jahr 1994 wegen der Umstellung von zwölf auf 13 Schuljahren keine Abiturienten an allgemeinbildenden Schulen im Land Brandenburg, so wird es im Sommer 2012 deutlich mehr geben als sonst. Denn durch die Verkürzung des Abiturs von bislang 13 auf zwölf Jahre an Gymnasien kommen gleich zwei Jahrgänge zur sogenannten Reifeprüfung.
Begabtenförderung. Wer mehr kann als das normale Einmaleins kann sich an sechs Beratungsstützpunkten im Land Brandenburg auf besondere Begabungen testen lassen. An den sogenannten Beratungsstützpunkten werden Eltern, Schülern sowie Lehrkräften Informations-, Beratungs- und Fortbildungsangebote zu Fragen der Identifizierung und Förderung von Schülern mit besonderen Begabungen gegeben. Für den Schulamtsbezirk Brandenburg, zu dem auch Potsdam und Potsdam-Mittelmark gehören, gibt es zwei Stützpunkte in Potsdam: Am Humboldt-Gymnasium in der Heinrich- Mann-Allee sowie an der Grundschule am Priesterweg in Drewitz. Zudem gibt es die sogenannten Leistungs- und Begabungsklassen, LuBK. Kinder können nach der vierten Klasse von der Grundschule in eine solche Spezialklasse wechseln. Voraussetzung: Ein positives Votum der Grundschule sowie eine Zensurensumme von nicht höher als fünf in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.
Computer. Das Ende der Kreidezeit ist in Schulen noch lange nicht in Sicht. Das sagt zumindest der Studie „Schule 2.0“ aus, die im Februar 2011 durchgeführt worden ist. 500 Lehrer wurden zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie an Schulen befragt. Dabei stellt sich heraus, dass Lehrer technikaffiner sind als der Durchschnitt der Bundesbürger – gleichwohl fällt die Nutzung in der Praxis noch wesentlich niedriger aus. Übrigens: Statistisch gesehen müssen sich im Land Brandenburg 8,5 Schüler einen Schulcomputer teilen. Für die Ausstattung der Medienkabinette ist der jeweilige Schulträger verantwortlich. Doch häufig gibt es aufgrund fehlender Finanzen Probleme bei der Ausstattung.
Deutsch. Ist nicht jedermanns Sache. Es ist übrigens interessant zu erfahren, welche Dialekte und Mundarten es in Brandenburg gibt. Offizielle Sprache an den Schulen sind sie zwar nicht, zu hören sind sie allerdings häufig. Da gibt es „helf mal“, „ne zue Tür“, „komm oben“ oder „dem sein Hefter“. Daher haben selbst Grundschüler schon mehrere Stunden Deutsch in der Woche. Übrigens: Laut Wikipedia gibt es die Mundart „Eberswalder Kanaldeutsch“ in Brandenburg. Interessant.
Entschuldigung. Das ist so eine Sache. Entschuldigt man sich oder bittet man um Entschuldigung? Fest steht, ein Anruf bei der Schule am Tag des Fehlens reicht in aller Regel, um einen Fehltag anzuzeigen. Bei begründeten Zweifeln an einem Fernbleiben aus gesundheitlichen Gründen kann die Schulleitung die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung allerdings verlangen. Und bei geplanten Fehltagen ist vorher die Lehrerin (bis drei Tage) beziehungsweise Schule (bis zu einer Woche) zu kontaktieren.
Freie Schulen. Nach dem Streit um die Finanzierung freier Schulen durch das Land ist nun eine Versöhnung angestrebt. Die Zuschüsse für nichtstaatliche Einrichtungen sollen gesenkt werden, vor allem bei Grundschulen, Oberschulen und beruflichen Schulen. Daher hat die evangelische Hoffbauerstiftung die Eröffnung einer Privatschule abgesagt. Potsdam hat ohnehin eine Ausnahmesituation, was freie Schulen betrifft. Jeder fünfte Schüler besucht eine der Privatschulen in der Stadt. Manch eine Werbung der Schulen darf als durchaus skurril bezeichnet werden. So beschreibt die Aktive Schule Potsdam ihr Konzept selbst so: „Es gibt keine Einteilung in Klassen, keine Noten, Prüfung und Unterricht. Hier wird Kindern nichts beigebracht. Der Lehrer dient als Ressource und ist niemand, der ungefragt Wissen vermittelt.“
Ganz flexibel. Jahrgangsübergreifender Unterricht hat an vielen Grundschulen in Potsdam zumindest in den ersten beiden Klassenstufen Einzug gehalten. Flexible Eingangsphase wird sie genannt. Gute Schüler können nach einem Jahr in die dritte Klasse wechseln, langsamere haben drei Jahre für die ersten beiden Jahre. Einige staatliche Schulen bieten dies auch in Klasse drei und vier an, die Montessori-Oberschule sogar bis Klasse acht.
Hausaufgaben. Wie viel Hausaufgaben dürfen es heute sein? Mathe, Deutsch und Physik. Dazu vielleicht noch ein bisschen Latein? Danke! Es gibt eine Verwaltungsvorschrift, in der der Umgang mit Hausaufgaben geregelt ist. So sollte die Zeit für Hausaufgaben für Grundschüler der fünften und sechsten Klasse 60 Minuten nicht überschreiten. In der Sek I sind es 90 Minuten. Zudem sollte eine Aufgabe von Freitag zu Montag nicht aufgegeben werden. Ob Hausaufgaben bewertet werden, hängt von vielen Faktoren ab. Beispielsweise kann ein Vortrag, der zu Hause ausgearbeitet, aber in der Schule gehalten wurde, bewertet werden. Grundsätzlich gilt laut Schulamt: In den Klassenstufen 1 bis 4 sollte nicht bewertet werden. Danach kann die Fachkonferenz festlegen, wie Hausaufgaben bewertet werden.
Internetseiten. Sie sind das Schaufenster der Schulen. Und wie in der Einkaufsstraße, gibt es schöne und weniger schöne Fenster. In den letzten Jahren sind viele Seiten in Eigeninitiative erstellt worden. Mal über eine Projektwoche, mal über eine Arbeitsgemeinschaft. Und doch gibt es selbst in Potsdam noch Schulen, die keine Internetpräsenz haben. Das Bildungsministerium hat in den vergangenen Jahren eine Datenbank im Internet angefertigt, in der alle Schulen samt Angebot, Fehlstunden, Profil und weiteren Eckdaten gelistet sind. Die Adresse: www.bildung-brandenburg.de/schulportraets
Jugendweihe. Ein Überbleibsel aus der DDR-Zeit? Keineswegs. 1852 tauchte der Begriff erstmals bei der Opposition zur Kirche auf. Einst war sie eine Feier zur Schulentlassung, daher wurde sie im Alter von 14 Jahren abgehalten. Das Alter ist bis heute geblieben, doch die Schule dauert meist länger. 1933 haben die Nationalsozialisten Jugendweihen verboten. Erst die DDR und die UdSSR haben die Jugendweihen wieder zelebriert. Es ist die weltliche Form der Konfirmation und Firmierung. Es gibt sogar einen anerkannten Träger der Jugendhilfe, den Verein Jugendweihe Berlin/Brandenburg, der wie andere Sozialvereine auch jedes Jahr noch Jugendweihen anbietet.
Klassenfahrten. Bildungsfahrt, Kursfahrt, Abschlussfahrt, Projekttage, Wandertage, Teambildung... Es gibt viele Begriffe für gemeinsame Ausflüge als Klasse. Für viele Schüler sind sie das beste am Schuljahr – doch nicht an allen Schulen ist das jedes Jahr möglich. Auch Lehrer haben ihre eigene Philosophie, solche Fahrten durchzuführen. Am Anfang des Jahres, um das Miteinander zu stärken. Oder als Bildungsfahrt im Rahmen des Unterrichts. Damit sich jeder Schüler die Fahrt leisten kann, gibt es inzwischen auch den Schulsozialfonds beziehungsweise das Bildungspaket, aus denen Geld für finanzschwache Familien zur Verfügung gestellt wird.
LRS und Dyskalkulie. Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Rechenschwäche. 15 bis 20 der Grundschüler sollen eine förderbedürftige Rechenstörung haben, sechs Prozent der Grundschüler seien extrem rechenschwach. In Potsdam sind die Anträge auf Hilfe in den letzten Jahren stark angestiegen. Das Jugendamt ist für die Förderung zuständig, wenn in der Schule alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Das Problem: Schulen haben aufgrund geringer Stundenzuweisungen für Lehrer kaum noch Möglichkeiten, zu reagieren.
Mittagessen. Schmeckt's? Was gab es? Hast du aufgegessen? Es sind die Standardfragen der Eltern an ihre Kinder, wenn es ums Thema Mittagessen geht. Mehrere Anbieter servieren ihr Mittagessen in den Schulen der Region. Ein Anbieter kocht diese in Westfalen, dort werden sie schockgefrostet und hier in den Schulküchen wieder aufgetaut. Die Frage nach Nährwerten und Nachhaltigkeit ist häufig gestellt. In Sachen Schulessen bietet das Land seit einem Jahr Hilfe. So ist die „Vernetzungsstelle Schulverpflegung“ mit Sitz in Potsdam eingerichtet worden. Geboten werden auch kostenfreie Veranstaltungen wie Infoabende für Interessierte, Arbeitstreffen für Schulen und Schulträger sowie Workshops für Entscheidungsträger. Na dann, Guten Appetit.
Nichtschülerprüfung. Das Wort klingt komisch, aber auch ein Nichtschüler kann tatsächlich eine Prüfung ablegen. Gemeint sind Schüler von freien Schulen, die keine Anerkennung des Landes haben und die dennoch eine offizielle Prüfung ablegen wollen. So bietet in Potsdam die Schule des zweiten Bildungsweges „Heinrich von Kleist“ solche Prüfungen an. Gelegentlich kommt es dabei sogar dazu, dass sich Menschen nach der Arbeit oder Lehre autodidaktisch auf das Abitur vorbereiten und dann an den Prüfungen teilnehmen können.
Oberschulen. Nach jahrelanger Ignoranz kommt die Schule so langsam auf die Füße. Vier der Schulen gibt es in Potsdam. Geht es nach der SPD und ihr Strategiepapier wird umgesetzt, wird sie tatsächlich neben Gymnasien zur Regelschule des Landes. Unterrichtet wird von der Klassenstufe sieben bis zehn, danach steht der Weg zum Abitur über die Sekundarstufen II der Gesamtschulen oder Oberstufenzentren offen.
Partnerschulen. Eine Partnerbörse offeriert die Angebote. Schulen aus zehn Ländern suchen derzeit eine Partnerschule in Deutschland beziehungsweise konkret in Brandenburg. So sucht die „Portstewart Primary School“ aus Nordirland eine Partnerschule. Mehrere polnische Schule suchen, auch die georgisch-deutsche Schule aus Tbilissi ist auf der Suche und das Gymnasium „Prytanee“ für Jungen aus Saint Louis in Senegal sind auf der Suche nach Schulkontakt. Die gesamte Liste wird beim Bildungsministerium aktualisiert. In Potsdam sind vor allem Partnerschaften nach Frankreich, Spanien und England beliebt.
Quatsch labern. Wer tut das nicht... aber wenn öffentlich über andere gelästert wird, hört der Spaß auf. Rund 13 000 Schüler werden jährlich im Land Brandenburg Opfer von Mobbing. Auch Lehrer werden gemobbt. Daher hat das Landesinstitut für Schule und Medien eine „Berlin-Brandenburger Anti-Mobbing-Fibel“ herausgegeben. Auf 38 Seiten wird beschrieben, wie sich Mobbing äußert, warum es sich so äußert und wie geholfen werden kann. Die zehn häufigsten Mobbinghandlungen sind: 1. Hinter dem Rücken sprechen. 2. Gerüchte und Lügen verbreiten. 3. Schimpfworte und Spitznamen. 4. Lächerlich machen. 5. Nicht zu Wort kommen lassen. 6. Vom Lehrer angeschrien werden. 7. Vom Lehrer „übersehen“ werden. 8. Abwertende Blicke und /oder Gesten. 9. Nachäffen. 10. Für dumm erklären. Die Broschüre ist übrigens vergriffen! Aber sie ist im Internet abrufbar unter http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/mobbing.html
Religionsunterricht. Humanistische Lebenskunde. Lebensgestaltung- Ethik-Religion, LER? Die Auswahl ist groß. Inzwischen bieten viele Schulen katholischen und evangelischen Religionsunterricht an. Wer dies vorzieht, kann auf LER verzichten – und andersherum. Allerdings muss gegenüber der Schule ein Teilnahmenachweis darüber erfolgen.
Schüleraustausch. Mit zwölf Jahren zum Abi muss eine Klasse auslassen, wer ein Jahr auf Reisen gehen will. Austauschprogramme oder Stipendien sind eine schöne Sache, damit die Reise nicht ganz so teuer wird. Welche Möglichkeiten es gibt, zeigt das Land Brandenburg per Mausklick auf den Bildungsserver.
Trends. Schüler beenden in Brandenburg seltener ohne Abschluss die Schule, immer mehr Schüler eines Jahrgangs schließen mit der Hochschulreife ab, elektronische Tafeln halten Einzug in die Schule, immer mehr Schüler schließen sich einem Sportverein an und immer mehr Lehrer gehen in Rente und werden durch junge Lehrer ersetzt.
Unterrichtszeit. Gähn – 8 Uhr ist Start, gelegentlich noch früher. Eine nullte Stunde gefällig? Für Schüler mit weiter Anreise wirklich früh. Festlegen kann den Start die Schulkonferenz. Die Regel sollte zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr sein, wird in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt. In Ausnahmefälle darf’s aber auch ein bisschen früher sein. Die Schulkonferenz darf in Abstimmung mit dem Schulträger ebenfalls festlegen, ob samstags unterrichtet wird. Darüber ist an manchen Schulen in der Vergangenheit nachgedacht worden, gerade weil durch die Schulzeitverkürzung bis zum Abitur der Tagesablauf sich in den achten bis zehnten Klassen enorm anstaut. Getraut hat sich bislang aber noch keine Schule, den Unterricht auf sechs Tage zu verteilen.
Vergleichsarbeiten. Wer kennt Vera? Spätestens in Klasse 3 und 8 haben alle Schüler von Vera gehört, den zentralen Vergleicharbeiten. Im vergangenen Jahr haben an den Vera-3-Tests mehr als 17 500 Schüler teilgenommen. Mehr als die Hälfte hat den Test mit den besten Kompetenzen 1a, 1b und 2 abgeschlossen – die Mädchen waren übrigens besser als die Jungs. In diesem Schuljahr werden die Vergleichsarbeiten im Mai 2012 geschrieben. Verbindliche Vergleichsarbeiten gibt es auch in Klasse 6. Sie soll in die Halbjahresnote einfließen, mit der sich die Schüler für eine weiterführende Schule bewerben. Natürlich wird in den Fächern Mathematik und Deutsch geprüft. Früher gab es auch Vergleichsarbeiten in den Klassenstufen 2 und 4 – sie sind abgeschafft.
Wettbewerbe. Es sind unzählige. Schülerwettbewerbe sie inzwischen fester Bestandteil des Brandenburgischen Konzeptes zur Förderung begabter Kinder und Jugendlicher. Die bekanntesten heißen „Jugend trainiert für Olympia“, „Jugend debattiert“, „Jugend forscht“. Unbekannter sind „Juvenes Translatores“ oder „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier!“. Eine Liste gibt es beim Landesinstitut für Schule und Medien.
X-beliebiges Verfahren. Oder: Ü7. Jedes Jahr machen sich Eltern ob der Zukunft der Sprösslinge verrückt. Welche Schule ist die Richtige nach der sechsten Klasse. Der Übergang von der Grundschule in die 7. Klasse heißt Ü7-Verfahren. Weiterführende Schulen präsentieren sich und ihre Angebote, Schüler wählen sie anschließend an. Dabei haben sie einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch. ES folgen persönliche Gespräche in den Schulen, prognostische Tests und die wochenlange Hoffnung, es geschafft zu haben. Doch nach Wünschen geht es häufig schon lange nicht mehr. Es ist in Potsdam eine taktische Wahl geworden. Das für viele Eltern undurchsichtige Wahlverfahren führt am Ende häufig zu einem Schulplatz, der eigentlich nicht gewollt war. Machen es andere besser? Berlin mit Sicherheit nicht: Ob das System, bei dem ein Teil der Plätze ausgelost wird, gerechter ist, bleibt offen.
Yaren. Mit Schulen in Potsdam und Brandenburg hat das nichts zu tun. Aber wer weiß was es ist, hat zumindest in Geografie gut aufgepasst. Viel Spaß beim googeln.
Zentrale Prüfungen. Ist das Abi an einem Gymnasium nun schwerer als an einer Gesamtschule oder nicht? Zumindest die Abschlussprüfungen sind die selben. denn im Land Brandenburg werden in den Fächern Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Geografie, Mathematik, Physik und Politische Bildung zentrale Prüfungen geschrieben. jab
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: