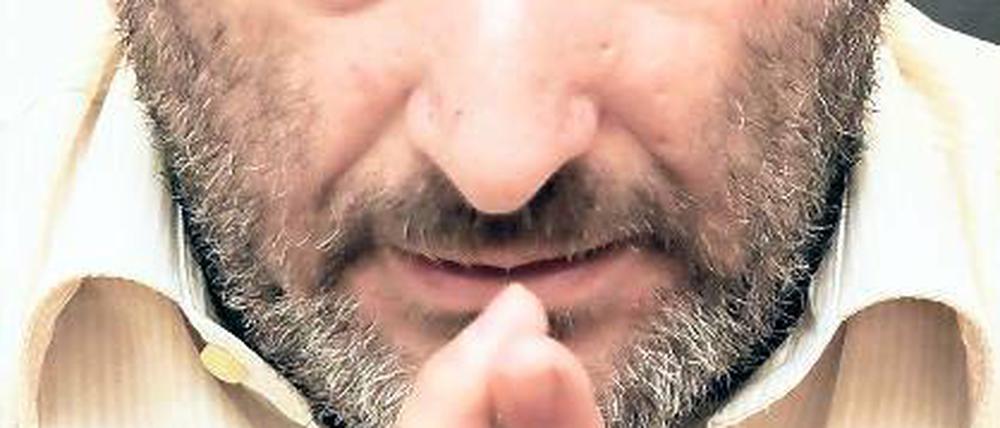
© M. Thomas
ZUR PERSON: „Eine Einigung ist nicht in Sicht“
„Am liebsten wäre mir, wie dem Bauverein, der Haberland-Bau würde realisiert“ „Man kann die Entscheidung über die Synagoge nicht ewig vor sich her schieben“ Der Vorsitzende des Synagogenbauvereins, Peter Schüler, über den Streit um eine Synagoge mit Gemeindezentrum in Potsdam
Stand:
Herr Schüler, welche Rolle spielt der Bauverein heute noch beim Bau der Synagoge, wenn das Land Brandenburg Bauherr und Finanzier ist und die jüdischen Gemeinden bestimmen sollen, was genau gebaut wird?
Bislang ist es unser Ziel, die Jüdische Gemeinde Potsdam zu unterstützen, eine Synagoge zu bekommen. Der Bauverein hat sich 2005 gegründet, um der damals deutlich größten Gemeine zu helfen. Für uns ist das jetzt eine neue Situation, nachdem das Land die Federführung an sich gezogen hat. Also, wir wissen um unsere komplizierter gewordene Rolle derzeit; gleichwohl wollen wir den Prozess solange begleiten, bis es eine Synagoge gibt.
Ihre Identitätsprobleme wären geringer, wenn sie sich nicht nur als Bauverein der Jüdischen Gemeinde Potsdam verstünden?
Das sehen Sie falsch. Wir sind nicht der Bauverein der Jüdischen Gemeinde Potsdam, sondern der Bauverein, der für alle Menschen jüdischen Glaubens eine Synagoge wünscht. Dass es zu einer großen Nähe zur Jüdischen Gemeinde kam, hat damit zu tun, dass es anfangs bis auf die Gesetzestreuen nur die eine Gemeinde gab. Sicher, im Zuge der Zuspitzung in den letzten drei Jahren und der Gründung der Synagogengemeinde gab es für den Bauverein die Notwendigkeit zu sagen, was uns näher liegt.
Wie kam es zu der Zuspitzung?
Nach dem Architekturwettbewerb hatte sich der Zweck des Bauvereins auf den Haberland-Entwurf konkretisiert. Es wurde mit der Realisierung begonnen. In dieser Situation tauchten Kritiker auf und sagten, der Gebetssaal sei zu klein, der Gebetssaal dürfe nicht im Obergeschoss liegen ... Was sagten Sie noch?
Der Entwurf sei unansehnlich
In der Tat, da kam Mitteschön dazu und sagte, der Bau füge sich nicht in die Umgebung ein, sei architektonisch schlecht. Natürlich hat das weder die Jüdische Gemeinde, die ihre Hoffnungen wieder enttäuscht sah, noch den Bauverein gefreut.
Die Kritiker wollten in den Bauverein – und durften nicht. Da gründeten diese die Synagogengemeinde und den Synagogen-Förderverein. Angesichts dessen: Würden Sie das heute wieder so machen?
Das ist nicht ganz richtig, die Synagogengemeinde hatte sich bereits früher gegründet. Ja, ich würde das heute wieder so machen. Ein Verein, wie unser Bauverein, ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen. Das Ziel war, im Februar 2009 den Haberland-Entwurf zu realisieren. Wir haben den Bau bereits entstehen sehen vor unseren Augen. Und dann kommen Leute und wollen etwas anderes, nicht den Haberland-Entwurf. Das ist ihr gutes Recht, das bestreite ich nicht. Selbstverständlich dürfen sie diese Meinung haben, doch müssen sie dann in den Verein?
Hätte man nicht ?
Selbstverständlich hätte man die Auseinandersetzung auch im Bauverein führen können. Was hätte das geändert?
Wäre es nicht auch möglich gewesen, einen Schritt zurückzugehen und zu erkennen: Es geht um eine Synagoge, nicht unbedingt um die Haberland-Synagoge?
Warum wollen Leute, die etwas anderes wollen als der Bauverein, unbedingt Mitglied im Bauverein sein? Wenn Ihr Verein mit 120 Mitgliedern eine Mitgliederversammlung machen will, und Sie kriegen Aufnahmeanträge von etwa 100 Leuten, von denen sie wissen, dass sie etwas anderes zum Ziel haben Nehmen Sie die dann in den Verein auf? Was glauben Sie, was dann passiert?
Sagen Sie es bitte.
Die Neuankömmlinge versuchen, die Majorität im Verein zu bekommen. Warum soll der Verein das wollen?
Um einen Diskurs zu ermöglichen
Wir haben den Diskurs nie gescheut. Im Gegenteil: Hätten wir die Kritiker aufgenommen, wäre dieser im Verein untergegangen oder die alten Mitglieder wären irgendwann weggegangen. Was hätte das gebracht? Wir haben den Haberland-Kritikern zu keinem Zeitpunkt das Recht abgesprochen, sich zur Synagoge zu äußern. Sie wollen etwas anderes als wir. Das dürfen sie, aber nicht im Bauverein.
Nun hat das Land eine Einigung der Gemeinden zur Vorbedingung für den Bau der Synagoge in der Schloßstraße gemacht. Was halten Sie von dem Ansatz?
Wir haben im März 2011 einem dreimonatigen Moratorium zugestimmt mit der Hoffnung, nach einer Einigung noch im Juni 2011 mit dem Bau beginnen zu können. Ich war schon damals skeptisch. Aber ich habe gesagt – und das ist noch heute meine Position – selbstverständlich wird sich der Bauverein einer Einigung der Jüdischen Gemeinde und der Synagogengemeinde nicht entgegenstellen. Wenn sie kommt, wunderbar. Aber inzwischen sind nicht drei, sondern 15 Monate vergangen und wir werden auch in diesem Jahr mit der Realisierung des Bauprojekts nicht beginnen können. Eine Einigung ist in meinen Augen nicht in Sicht. Und das lässt mich an der Sinnfälligkeit dieser Prämisse zweifeln. Ich verstehe, wenn die Regierung sagt, wir wollen dieses Vorhaben nicht im Streit realisieren. Aber man muss auch irgendwann zur Kenntnis nehmen: Wenn andere nicht entscheiden, muss man selbst entscheiden. Ich will das gar nicht vorwegnehmen. Es kann alles Mögliche sein.
Zum Beispiel?
Der Bauverein ist nach wie vor der Meinung, dass der Haberland-Entwurf alle Bedingungen erfüllen kann und deshalb gebaut werden sollte. Er ist mehrfach modifiziert worden, um den Kritikern entgegenzukommen. Der Gebetssaal ist größer, jetzt haben wir mehr Plätze. Etwa 250 statt bisher etwa 165. Es sind die Räume für die Verwaltung im Erdgeschoss umgestaltet worden, sodass alle Funktionen, die die beiden Gemeinden brauchen, dort untergebracht werden können. Allerdings wurde der Gebetssaal nicht eine Etage heruntergenommen, wie das die Synagogengemeinde verlangt.
Wie kam er überhaupt ins Obergeschoss?
Vom orthodoxen Rabbinerrat kam die Bedingung, dass über dem Gebetssaal, über dem eigentlich religiösen Zentrum des Gebäudes, keine weitere profane Nutzung sein sollte. Auch das ist umstritten, das will ich gar nicht leugnen.
Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wenn Ud Joffe da mit einziehen soll, dann muss auch gelten, was er und sein Rabbiner für richtig halten.
Ja, der Köder muss dem Fisch schmecken. Aber ist Ud Joffe der Fisch? Für mich sind das die hier lebenden Menschen jüdischen Glaubens. Wir werden feststellen, dass sich nicht alle Menschen jüdischen Glaubens in Potsdam einigen werden. Das zu erwarten wäre unrealistisch. Aber die Konsequenz kann ja nicht sein, gar keine Synagoge zu bauen, weil wir keine finden, die allen gefällt.
Also Sie sagen, jetzt bauen, egal, was da noch an Widerstand ist?
Man kann die Entscheidung nicht ewig vor sich her schieben. Wenn nicht bald eine Synagoge mit Gemeindezentrum gebaut wird, sehe ich das Ziel, in Potsdam nachhaltig jüdisches Leben anzusiedeln in Gefahr. Die Alten werden weniger, die Jungen sind sehr viel mobiler und werden ihre Orte für die Ausübung jüdischen Lebens dort suchen, wo sie sie finden können und das wäre dann nicht hier. Im schlimmsten Fall wäre die Entscheidung, man baut gar nicht. Das wäre die schlechteste Entscheidung. Am liebsten wäre mir, wie dem Bauverein, der Haberland-Bau würde realisiert. Ich finde ihn schön. Wenn gesagt wird, er sei nicht erhaben genug, kann ich wenig damit anfangen. Was heißt das, erhaben? Dass er sich wenig aus seiner Umgebung heraushebt? Das tut der Entwurf. Er unterscheidet sich mit seiner architektonischen Sprache deutlich von seiner Umgebung. Er ist für mich erhaben, etwas Besonderes. Er sei nicht sakral genug, wird gesagt. Damit kann ich auch wenig anfangen. Was heißt sakral? Eine Synagoge ist kein Tempel.
Als Gotteshaus erkennbar wäre gut
Es ist eine Schule. Es ist ein Begegnungszentrum. Es ist eigentlich viel mehr Gemeindezentrum als Gotteshaus
Die Erkennbarkeit der jüdischen Nutzung ist für eine Synagoge nicht zuviel verlangt.
Ich empfehle Ihnen dieses Buch, da können Sie sehen, was eine Synagoge ist! (Zeigt das Buch von Katrin Keßler „Ritus und Raum der Synagoge“.)
Jedes Zelt kann eine Synagoge sein aber in einer Stadt gibt es eben das Bedürfnis nach einer erkennbaren Synagoge.
Wieso ist sie nicht erkennbar? Dieser Entwurf hebt sich doch deutlich ab. Er hat ein Riesenportal, vier Meter hoch.
Es gibt jetzt einen Vorschlag vom Förderverein. Der sagt, wir nehmen die Büros aus der Synagoge heraus und stecken sie in das Hotel „Zum Einsiedler“, das wieder aufgebaut wird. Was halten Sie davon?
Dazu kann ich mich nicht äußern, weil ich ihn nicht kenne.
Möchten Sie ihn gerne kennenlernen?
Ja sicher will ich ihn kennenlernen. Wenn es ein realistischer Vorschlag ist, dann muss man ihn auch verfolgen. Aber eines ist für die Jüdische Gemeinde und auch für den Bauverein von zentraler Bedeutung: Dass man nicht religiöses Leben und Traditions- und Kulturpflege, Gemeindeleben, soziales Leben entkoppelt, dass man das voneinander trennt.
Das bietet der Vorschlag. Außen Synagoge und „Einsiedler“, innen gibt es Übergänge.
Wir halten den Haberland-Entwurf nach wie vor für einen sehr guten Entwurf und die Kritik nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber wenn es keine Einigung auf den Haberland-Entwurf, aber eine mögliche Einigung auf ein anderes Projekt gibt, dann sträuben wir uns nicht.
Sie hatten Differenzen mit Kulturstaatssekretär Martin Gorholt. Ist jetzt Funkstille?
Also, nein, es ist keine Funkstille. Aber ich denke, dass Herr Gorholt nach wie vor glaubt, alles richtig gemacht zu haben und nicht so richtig verstanden hat, warum wir kritisch reagiert haben. Aber das hindert uns nicht, miteinander zu reden. Am 18. Juni wird ein weiteres Gespräch stattfinden bei Herrn Gorholt.
Denken Sie, dass Gorholt kein unparteiischer Vermittler ist?
Wir sagten in der Tat, lieber Matthias Platzeck, nimm dich dieses Problems an, es ist schwierig. Aber das hat er nicht gewollt. Vielleicht weil es schwierig ist, oder weil er viele andere schwierige Probleme zu lösen hat. Wie dem auch sei: Sowohl die Jüdische Gemeinde als auch der Bauverein reden weiter mit Herrn Gorholt und lehnen ihn nicht ab.
Sie können sehr gut mit dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde. Nehmen Sie Einfluss auf deren Entscheidungen?
Wir stehen der Jüdischen Gemeinde nahe. Wir sind in permanentem Gespräch. Zu bestimmten Fragen werden wir um Rat gebeten. Den geben wir auch. Soweit es die Gespräche mit der Synagogengemeinde betrifft, haben wir gesagt, das ist Eure Angelegenheit, Ihr seid diejenigen, die diese Gespräche führen, es geht um Euch. Wir geben der Jüdischen Gemeinde keinerlei Empfehlungen.
Niemand spekuliert darauf, dass ein Scheitern der Gespräche dazu führen könnte, dass dann doch Haberland gebaut wird?
Nein. Es spekuliert niemand im Vorstand des Bauvereins und auch nicht im Bauverein darauf, dass man durch ein Scheitern der Gespräche zurück zum Haberland-Entwurf kommen könnte. Was es allerdings gibt, ist eine sehr verbreitete Enttäuschung darüber, dass die Gespräche nicht wirklich zu einer Annäherung, oder ich sage mal, jedenfalls nicht zu einem erkennbaren Ergebnis geführt haben.
Was treibt Sie an, sich zu engagieren?
Potsdam hat viele jüdische Kontingentflüchtlinge aufgenommen. Das habe ich mit großer Sympathie beobachtet und gesehen, dass eine neue Gemeinde entstanden ist. Das war 1993 oder 1994. Und ich habe gemerkt, dass die Gemeinde Schwierigkeiten hat, Fuß zu fassen. Dazu gehörte ein Ort, an dem sie ihre Religion praktizieren können. Das ist ja ein elementarer Bestandteil des Gemeindelebens. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft von Potsdam eine Mitverantwortung hat. Also bin ich dem Bauverein beigetreten. Das war 2005.
Hat das auch mit Ihrer persönlichen Lebensgeschichte zu tun?
Ich bin als Sohn jüdischer Eltern in der DDR groß geworden. Meine Mutter war, glaube ich, sehr ängstlich darauf bedacht, dass wir, ihre Kinder, nicht auffallen. Dass wir um Himmels willen nicht anders sind als die anderen. Sie hat immer Angst gehabt vor Antisemitismus, auch nicht ganz grundlos. Ja, wir sind Juden, unsere Geschichte hat damit zu tun, wir waren in England in der Emigration, weil wir in Deutschland unseres Lebens nicht sicher waren, aber trotzdem hat sie gesagt, so nach außen hin, versucht mal ganz normal zu sein. Natürlich erlebe ich das als schmerzlichen Verlust. Ich mache meiner Mutter keine Vorwürfe, ich habe sehr viel Verständnis dafür, aber trotzdem merke ich, dass etwas fehlt, so ein Stück kulturelle Identität.
Sie suchen nach einer jüdischen Identität?
Ich werde die nicht finden. Nein, die Mühe kann ich mir sparen. Das ist Geschichte, ich bin assimilierter Jude, und das wird sich auch nicht ändern. Ich habe mich damit abgefunden. Aber ich merke, es ist ein Verlust. Es ist etwas, was eigentlich dazu gehört hätte. Das kann man nicht mehr reparieren. Das wäre künstlich, das wäre aufgesetzt, ich kann Geschichte ja nicht rückgängig machen. Aber ich will denen, die hier leben, zumindest ermöglichen, dass sie einen solchen Verlust vermeiden können.
Das Interview führten Sabine Schicketanz und Guido Berg
Peter Schüler wurde 1952 in Berlin geboren. Er studierte Physik und schloss 1975 als Diplom-Physiker ab. Anschießend arbeitete er 15 Jahre als Physiker, bevor er für die Bündnisgrünen in den Brandenburger Landtag einzog. Danach studierte er von 1994 bis 1998 an der Universität Potsdam Rechtswissenschaften. Seit 2001 arbeitet Peter Schüler als Rechtsanwalt. Seit 2008 ist er Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, seit 2011 leitet er den Synagogenbauverein.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: