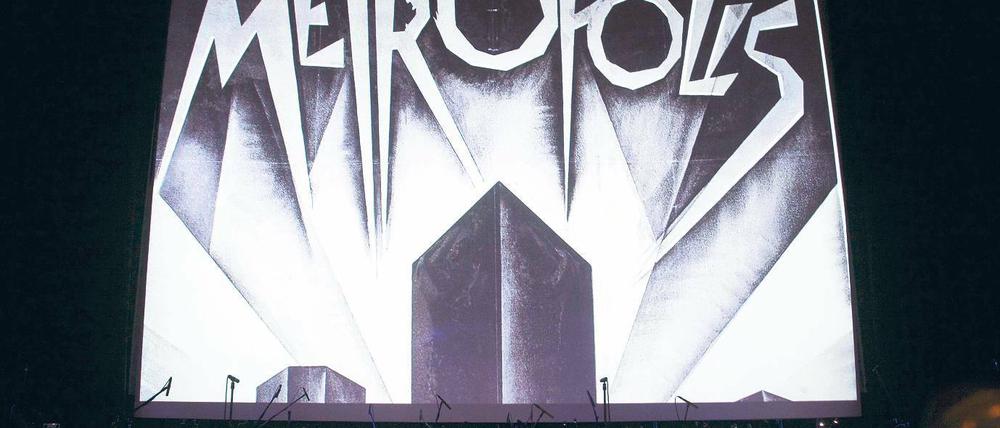
© ddp, Deutsches Filminstitut, privat
Von Susanna Maier: Immer vorwärts gedacht
Die HFF-Studentin Felicitas Milke promoviert über die Filmlegende Erich Pommer
Stand:
Wenn der 93-jährige John Pommer die Liedzeilen „Das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder“ hört, muss er unweigerlich an einen berühmten Film seines Vaters denken. Dem Sohn des legendären UFA-Produktionschefs Erich Pommer (1889-1966) fällt dann dessen erfolgreiche Tonfilmoperette „Der Kongreß tanzt“ aus dem Jahr 1931 ein. An zahlreichen Rückblicken dieser Art ließ John Pommer die Doktorandin Felicitas Milke von der Hochschule für Film- und Fernsehen (HFF) bei einem Besuch in Los Angeles teilhaben. Die Referentin am Potsdamer Erich Pommer Institut hat in den vergangenen Monaten ehemalige Produzenten aufgesucht, und tiefe Einblicke in Erich Pommers Leben gewonnen.
Vor sieben Jahren beschäftigte sie sich das erste Mal mit dem deutsch-jüdischen Filmproduzenten, der mit Filmen wie „Metropolis“, „Der blaue Engel“ und „Das Cabinet des Dr. Caligari“ Filmgeschichte geschrieben hat. Er arbeitete zusammen mit Fritz Lang und Alfred Hitchcock, förderte Marlene Dietrich und Maximilian Schell. „Er hat immer vorwärts gedacht und das Berufsbild des Produzenten professionalisiert“, so Milke. Vom Stummfilm, über den Tonfilm bis hin zum Anti-Kriegsfilm, Pommer habe zahlreiche deutsche Filmstile geprägt und vorangetrieben. Ihr Wandeln auf seinen Spuren vergleicht die Promovendin mit einer kleinen Mission: Felicitas Milke möchte verhindern, dass Pommer in Vergessenheit geraten könnte. „Manchmal wird sein Name in Filmberichten einfach weggelassen“, sagt sie.
Ihre Dissertation soll nun auch Aufschluss geben über die Rolle Pommers als Filmoffizier. „Er wurde berufen, um sich um den Wiederaufbau der deutschen Filmwirtschaft zu kümmern“, erklärt Milke. Die „Entnazifizierung“ der Filmleute habe auch dazu gehört. Dafür kehrte Pommer 1946 nach Deutschland zurück. Nachdem sein Vertrag mit der UFA durch das NS-Regime 1933 aufgelöst worden war, war Pommer nach Hollywood emigriert. Dass er als Filmoffizier für die Menschen vor Ort sorgte, zeichne ihn besonders aus. „Genauso hat er sich immer schützend vor sein Filmteam gestellt“, sagt Milke. Seine Nähe zum Team bewundert sie heute noch. „Er hat immer alle mit Respekt behandelt“, fügt sie hinzu.
Aufgrund seiner Rolle als Filmoffizier sei er aber häufig angefeindet und kritisiert worden. „Viele fragten sich natürlich, warum darf manch einer trotzdem weitermachen?“, erzählt Milke. Auch die Amerikaner zeigten sich skeptisch, schließlich befürchteten sie, dass Pommer dem deutschen Film wieder zu altem Glanz verhelfen könnte, so Milke. Der Produzent blieb schließlich drei Jahre in Deutschland. „Seine Frau machte sich große Sorgen um ihn“, erzählt Milke. Pommer hatte Diabetes und zu der Zeit bereits einen Herzinfarkt erlitten. Gerade die innige Korrespondenz mit der Familie während dieser Zeit fasziniert Milke, bis zu 2000 Briefe hat sie bisher durchgesehen.
So hat sich Felicitas Milke immer weiter an die persönliche Haltung Erich Pommers herangetastet, und durch Treffen mit dem Sohn eine persönliche Verbindung aufgebaut. Denn für Milke sei Pommer inzwischen zu einem Vorbild geworden, deshalb schließt sie es nicht ganz aus, künftig wieder einmal als Produzentin zu arbeiten. „Dazu braucht man aber damals wie heute viel Idealismus“, ergänzt sie.
Durchhaltevermögen gehöre auch dazu. Das bekam auch Pommer zu spüren. Während seines amerikanischen Exils sei er in Hollywood nie richtig angekommen, seine Familie musste sogar ihr Haus verkaufen. „Trotzdem ließ er den Film nie aus den Augen“, so Milke. Schon frühzeitig habe er sich mit dem Anti-Kriegsfilm auseinandergesetzt. „Damit hat er sich natürlich unpopulär gemacht, mitten in Zeiten von Wiederaufrüstung in der Bundesrepublik“, sagt Milke.
Dem Film „Kinder, Mütter und ein General“ (1955) misst Felicitas Milke deshalb viel Bedeutung bei. Dass Pommer sich plötzlich mit sehr ernsten Themen beschäftigte, spiegelte auch den Schnitt in der Gesellschaft wieder. Man hatte sich nicht nur von den leichten Tanzfilmen entfernt, sondern auch von dem Lebensgefühl, das sie vermittelten. Dennoch wurde Pommer durch die Verleiher dazu gedrängt, das traurige Ende des Films zu streichen, so viel wollte man der deutschen Bevölkerung dann doch nicht zumuten, erklärt Milke. In Pommers Version, die den Golden Globe gewann, kehren die Kinder-Soldaten nach dem Krieg nicht mehr nach Hause, eine Mutter eines Soldaten sagt deshalb: „Sie haben uns vergessen.“ Damit wollte der Produzent die Ausweglosigkeit, die Trostlosigkeit des Krieges beschreiben. In der geänderten Version hat der Film ein offenes Ende.
Susanna Maier
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: