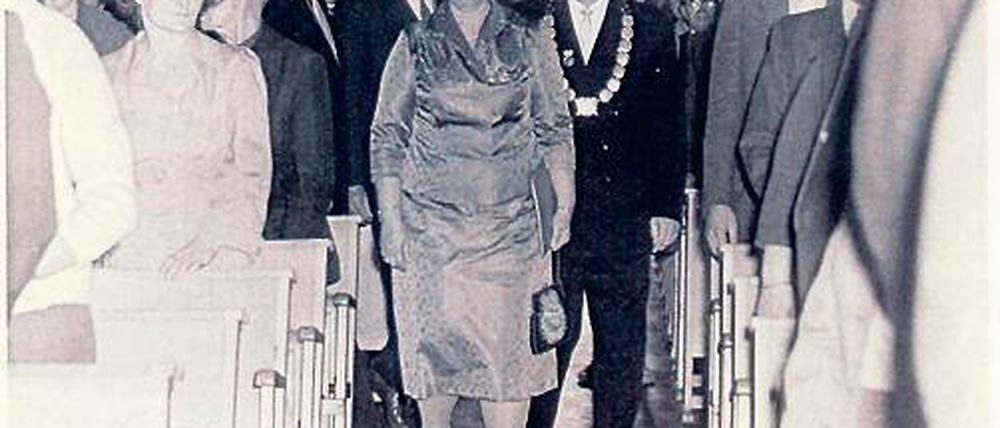
© privat
Homepage: Studium nach sozialer Einstufung
An der Pädagogischen Hochschule Potsdam fand die Eröffnung des Studienjahres 1958 mit gerade mal 350 Studienanfängern statt. Kinder aus Arbeiter- und Bauernfamilien wurden bevorzugt. Von Josef Drabek
Stand:
Josef Drabek, 1939 in Böhmen geboren, studierte von 1958 bis 1962 an der Pädagogischen Hochschule Potsdam, dem Vorläufer der heutigen Potsdamer Universität. Das Studium schloss er als Fachlehrer für Deutsch und Geschichte ab. Derzeit schreibt Drabek seine Erinnerungen „Von Böhmen nach Brandenburg. Wege zwischen Weltkrieg und Wende“, deren erster und zweiter Teil vorliegt. Der dritte Teil zu Brandenburg beginnt mit der Studienzeit, Auszüge daraus erscheinen in den kommenden Monaten in den PNN.
Nachdem unsere „Fünf-Mann-WG“ komplett war (siehe PNN vom 18. Juli 2014), ging es am 8. September gemeinsam zur Hochschule, wo das Studienjahr 1958/59 eröffnet wurde. Die Eröffnung für die gerade mal 350 Studienanfänger fand im Auditorium maximum statt, das auch wir studentisch salopp Audimax nannten. Rektor Günter Scheele begrüßte alle „Neuen“ und drückte die Hoffnung aus, dass sie sich dieser Auszeichnung würdig erweisen, wie er sagte.
Interessant war die genannte soziale Zusammensetzung des Studienjahrgangs, in dem 73,4 Prozent angeblich aus Arbeiter- und Bauernfamilien stammten. Auch wenn manche Zuordnung die Statistik aufbesserte, galt solche Proportion als typisch und wurde mit der Wiedergutmachung für historische Benachteiligung begründet. In diesem Zusammenhang erhielten auf Grundlage der sozialen Einstufung und einer Bescheinigung über den Bruttoverdienst der Eltern 98,2 Prozent unseres Jahrgangs ein Stipendium.
Auch ich gehörte zu den Empfängern einer solchen Zuwendung, denn mein Vater bekam in Folge kriegsbedingter Schwerbeschädigung nur eine Invalidenrente von 146,20 Mark pro Monat. Deshalb wurde mir ein monatliches Stipendium von 190 Mark zuerkannt. Davon gingen zehn Mark für Unterkunft und 70 Mark für Vollverpflegung (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot) ab. Der Rest reichte für Bücher, Schreibmaterial, Fahrkarten, Besuche von Veranstaltungen und Gaststätten.
Als Halbwaise erhielt mein Kommilitone Richard denselben Betrag, ohne den er nach eigener Aussage nicht hätte studieren können. Sozial bedingt bekam Kommilitone Most die nächstniedrige Stufe von 140 Mark, ebenso wie der unter uns wohnende Klaus. Dieser wurde deshalb beim Prorektor für Studienangelegenheiten vorstellig, weil sein als Kartograf tätiger Vater weniger verdiene als mancher Arbeiter. Daraufhin erklärte „Papa Höhne“, dass der Bruttoverdienst zwar ein wichtiges Kriterium sei, die soziale Herkunft aber auch, und danach würden Kinder von Arbeitern und Bauern eben bevorzugt.
Außer der Eröffnung und ähnlichen Veranstaltungen fanden im Audimax jahrgangsumfassende Vorlesungen statt wie die zum gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium, das seit 1951 obligatorischer Bestandteil der Ausbildung war – und ambivalent aufgenommen wurde. Einerseits ging es uns dabei ähnlich einer Feuchtwanger-Figur, wonach sich bei Anwendung der Prinzipien des Marxismus alles „wie von selbst“ ordnet. Andererseits nahmen wir dieses Studium wenig ernst und betrieben es eher nebensächlich. Die zugehörigen Seminare fanden nämlich nur alle 14 Tage am sonst freien Sonnabend statt, und bei guter Mitarbeit konnte man von abschließenden Leistungskontrollen befreit werden.
Anders war es bei Allgemeiner Pädagogik, wozu Professor Walter Wolf schulbezogene Lektionen hielt. Der einstige Lehrer hatte über ein demokratisches Schulsystem nachgedacht und an seiner Durchsetzung mitgewirkt. Komplettiert wurde dieses Fach durch Vorlesungen zur Geschichte der Erziehung, die Werner Flach hielt, dessen gleichnamiges Buch bereits die 5. Auflage erreichte und ins Japanische übersetzt wurde. Darin waren Pädagogen wie Pestalozzi gewürdigt, der die „Einheit von Kopf, Herz und Hand“ anstrebte und heute ebenso vergessen scheint wie Wilhelm von Humboldt, der sich für ein „einheitliches Schulsystem“ aussprach.
Über Entwicklungspsychologie, Schülerbeobachtung und -beurteilung referierte der 1958 Professor gewordene Kurt Zehner. Obwohl alles interessant war, sprang unsere am Audimax-Ausgang platzierte WG immer zur Mittagszeit auf und stürmte zur Mensa. Das muss so auffällig gewesen sein, dass der Lektor nachfragte, wer diese fünf Studenten seien, die jedes Mal derart fluchtartig hinausrannten. Über 20 Jahre später traf ich den Hochschullehrer wieder. Er konnte sich noch gut an die „Saalflüchter“ von damals erinnern.
Fortsetzung folgt
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: