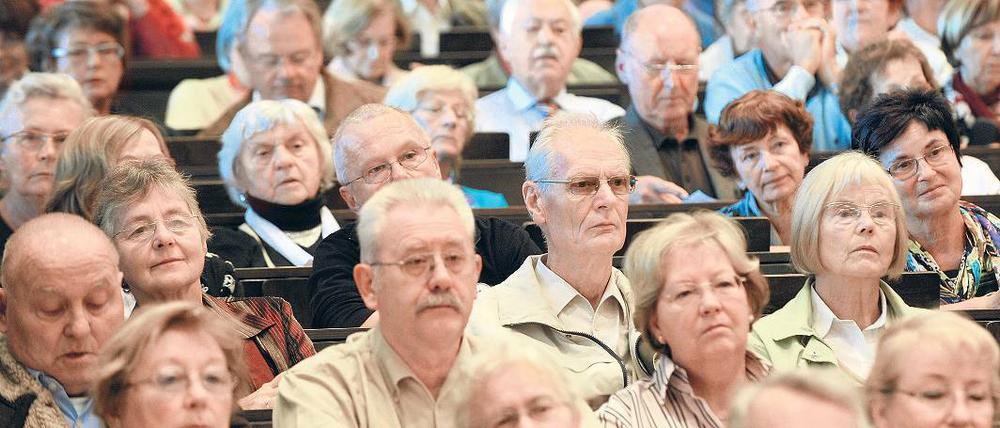
© dpa
Homepage: Versorgungsmentalität reicht nicht aus
Die Fachhochschule Potsdam forscht zum demografischen Wandel in Brandenburg
Stand:
Der demografische Wandel stellt Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen: Immer weniger junge Menschen müssen in Deutschland immer mehr alte Menschen versorgen. Ohne Eigeninitiative der Regionen, ehrenamtliches Engagement und ohne Vernetzung professioneller, kommunaler und nachbarschaftlicher Hilfen wird die Lebensqualität der älteren Bevölkerung leiden. Darüber herrscht unter Politikern und Wissenschaftlern weitgehend Einigkeit. Strittig ist, wie viel freiwilliges Engagement von den Bürgern erwartet werden kann. Um diese Fragen ging es auch bei der Potsdamer Tagung „Adieu späte Freiheit? Altern in Zeiten von Aktivierung, Selbstmanagement & gesellschaftlicher Indienstnahme“, die unlängst von Jutta M. Bott, Professorin für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, veranstaltet wurde.
Mit einem interdisziplinären Forscherteam des Fachbereichs Sozialwesen hat Bott in den vergangenen drei Jahren untersucht, was Eigeninitiative, Engagement und Vernetzung bewegen können. Der Titel des Projektes, an dem sich auch der Verein Soziale Stadt Potsdam mit dem „Haus der Generationen und Kulturen“ am Schlaatz und die „Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg“ beteiligten: „Gut Leben im (hohen) Alter“. Die Wissenschaftler verbanden dabei Theorie und Praxis. Am Schlaatz und in fünf Dörfern im Westhavelland entwickelten sie gemeinsam mit Bewohnern Ideen, um den dort schon jetzt spürbaren Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken. Alten und hilfsbedürftigen Menschen sollte die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ausreichende Betreuung und Unterstützung sowie der Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglicht werden.
Die Projektergebnisse bestätigen Bott in ihrer Überzeugung, dass den Herausforderungen mit tragfähigen Netzwerke begegnet werden müsse: „Eine Versorgungsmentalität reicht nicht aus.“ Die Tragfähigkeit der Netzwerke haben auch ihre Mitarbeiter Santje Winkler und Sven Tepperwien als Schwierigkeit erkannt. „Das Grundinteresse ist da, aber es ist schwierig, die Leute dauerhaft bei der Stange zu halten. Außerdem sehen viele die Notwendigkeit nicht, sich bereits jetzt damit zu beschäftigen“, so Winkler. Am Schlaatz herrsche die Einschätzung vor, dass Nachbarschaftshilfe bereits ganz gut funktioniere, so die Diplom-Sozialarbeiterin. In ländlichen Regionen werde meist die Familie als Garant dafür gesehen, auch im hohen Alter zu Hause bleiben zu können. Ihr Kollege, der Diplom-Psychologe Sven Tepperwien erlebte ähnliche Hürden. „Die einmalige Aktivierung ist kein Problem, aber viele Dorfbewohner haben lange körperlich gearbeitet und wollen sich schlicht ausruhen. Außerdem gibt es schnell ein Nachfolgeproblem, wenn ein engagierter Älterer krank wird, da die Jüngeren zur Arbeit pendeln und selten verfügbar sind.“
Was in der Theorie einfach klingt, erwies sich in der Praxis als schwierig. „Wir haben auf das Nachbarschaftsprinzip gesetzt, aber das hat Grenzen. Es setzt viel Vertrauen voraus, das man nicht von außen erzwingen kann“, so Winkler. Beim Aufbau eines Netzwerks sei es schwierig, von allen Beteiligten die erforderliche Verbindlichkeit und Verantwortung einzufordern. „Jedes Dorf oder städtische Quartier bräuchte einen dauerhaft anwesenden Sozialarbeiter oder Netzwerker“, lautet Botts Fazit. Auch Selbstorganisation müsse gelernt werden, ansonsten wechsele „euphorisches Engagement mit Frustration, da einzelne Ehrenamtliche schnell überlastet werden.“ Auch Josefine Heusinger, Wissenschaftlerin am Institut für Gerontologische Forschung in Berlin, sieht Netzwerke als Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels in Deutschland. Sie funktionierten aber nur, wenn freiwilliges Engagement im eigenen Interesse passiere und das Recht auf Mitbestimmung gewährleistet sei: „Netzwerke brauchen politischen Willen, materielle Ressourcen und engagierte Menschen jeden Alters.“
Bott fordert eine klare und offene Debatte darüber, ob die Beteiligung aller an ehrenamtlichen Strukturen zu viel verlangt sei. Eine politische Auseinandersetzung unter Berücksichtigung der Heterogenität des Alters vermisst auch der Leiter des Instituts für Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Universität Duisburg-Essen, Fabian Kessl. „Es muss auch die Erlaubnis bzw. das Recht auf Nichtaktivität geben.“ Kessl forderte im Hinblick auf die zunehmende Altersarmut, insbesondere von Frauen eine Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit. Beim Thema demografischer Wandel rät er, nicht nur die bundesrepublikanische Bevölkerungsentwicklung im Blick zu haben, sondern auch die Entwicklung der Weltbevölkerung: „Weltweit ist die Überalterung kein Problem.“Maren Herbst
Maren Herbst
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: