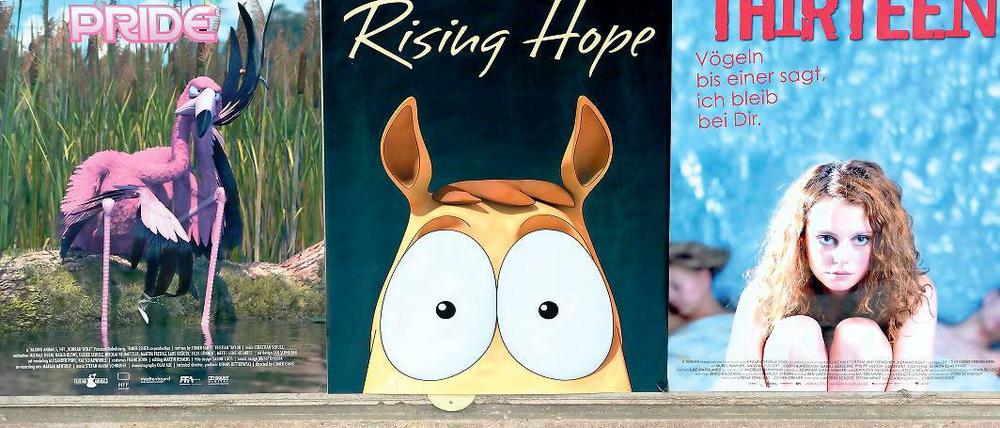
© dpa
Homepage: Was eine gute Geschichte ausmacht
Bei der Drehbuch-Konferenz an der Filmuniversität geht es um das Geheimnis guter Drehbücher
Stand:
Als das Licht im Kinosaal der Filmuniversität Babelsberg wieder angeht, werden Taschentücher gezückt und Tränen von feuchten Augen getupft. Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden, hat den Film von Annekathrin Wetzel nicht nur unterstützt: Der Kurzfilm ist von einem Ereignis in Knoblochs Leben – der dramatischen Rettung vor Nazischergen – inspiriert. Es ist großes Gefühlskino.
In 3-D schildert Wetzel die Freundschaft der jüdischen Mutter Knoblochs und ihrer Freundin, zwei Schauspielerinnen in München zur Zeit des Naziregimes. In weniger als 20 Minuten entfaltet sich das bedrückende Panorama. „Wir wollten die Zeit und das Geschehen wirklich greifbar machen“, begründet Wetzel das 3-D Format. Die Entscheidung dafür fiel bei der Entwicklung des Drehbuchs für den Film. Weil das Projekt nicht nur auf Filmfestivals und im Fernsehen Beachtung finden soll, sann Wetzel zusammen mit ihrem Koproduzenten Michael Geidel nach neuen Möglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken. So entsteht gegenwärtig ein Videospiel, in dem die Spieler den Gang der Handlung und den Schluss der Geschichte beeinflussen können. Damit möchte Wetzel das historische Geschehen auch für Gedenkstätten und Museen plastisch werden lassen. „Wer heute eine Filmgeschichte entwickelt, sollte nicht nur an das Kinoformat denken“, sagt sie.
Auch Kerstin Stutterheim, Dramaturgie-Professorin an der Filmuniversität und Organisatorin der 7. International Conference des Screenwriting Research Network ebendort, betont, dass Drehbuchschreiber und Autoren, die Filmstoffe entwickeln, die neuen Medien im Blick haben sollten. „Filme laufen heute im Kino, im Fernsehen, aber auch auf dem iPad, dem Tablet, im Internet“, stellt Stutterheim fest. Der Fernsehabend, der zum festgelegten Sendetermin beginne, sei für jüngere Zuschauer kaum noch vorstellbar. „Für einen linearen Konsum zu produzieren ist nicht mehr marktgerecht“, sagt Stutterheim.
Dementsprechend diskutierten die versammelten Filmwissenschaftler und Filmemacher die Möglichkeiten, schon beim Schreiben der Vorlage für den Film verschiedene Medienformate zu berücksichtigen. Wie verändert sich das Verhältnis von Stoffentwicklung und Umsetzung im Film gegenwärtig?
Hier ist vieles im Umbruch. Der einsame Drehbuchschreiber mit einer genialen Idee vor dem weißen Blatt Papier hat in einem mittlerweile hoch strukturierten und industriell organisierten Produktionsprozess kaum noch Platz. „Drama Queen“ lautet passenderweise der Titel der Software, die die Potsdamerin Evi Goldbrunner vorstellt. Das Computerprogramm zergliedert das Drehbuch in viele einzelne Sequenzen und Schritte. Jeder Person wird ein Handlungsstrang zugeordnet, der sogleich in das Gesamtgeschehen eingebettet wird. Die verschiedenen Handlungshöhe- und Wendepunkte sind in einem Diagramm verzeichnet. Das verändert sich, wenn dem Protagonisten Schlimmes widerfährt oder der Plot eine neue Richtung nimmt. „Das Programm ersetzt natürlich weder die Idee noch das Talent des Drehbuchschreibers“, weiß Goldbrunner, „aber es verschafft mehr Übersichtlichkeit beim Schreibprozess.“
Welche Fallstricke die Stoffentwicklung mit sich bringen kann, war der Filmemacherin Jutta Brückner völlig unklar, als sie vor etwa 40 Jahren ihren ersten Film drehte. „Ich repräsentiere hier die zweite, weibliche Hälfte der Filmproduktion“, leitet Brückner ihren Vortrag ein. Die Autorin hat sich auf Porträts über Frauen spezialisiert. Ihren ersten Film „Tue recht und scheue niemand“ collagierte sie aus Fotos etlicher Frauen, zentrales Motiv jedoch war ihre Mutter. Der kam sie während der Arbeit am Film näher, als das zuvor je der Fall gewesen war. Um den Film zu produzieren, spazierte Brückner recht unbedarft in das Büro eines Fernsehproduzenten, schilderte ihm ihr Vorhaben und erhielt völlig überraschend überraschend eine Geldzusage. „Das geht heute natürlich nicht mehr“, sagt Brückner.
Über die schwierigen Bedingungen der Filmproduktion berichtet Milcho Manchevski, der zugleich Autor und Regisseur ist. „Nicht die Mechanik des Films ist wichtig, es geht um die Bedeutung hinter den Bildern“, behauptet Manchevski.
So ähnlich sieht es auch Kerstin Stutterheim. „Filme leben heute noch mehr als früher vom einzelnen Bild und seiner Bedeutung“, vermutet sie. Eine gute Geschichte zeige sich, wenn der Zuschauer das Geschehen selber weiterdenke. „Die jüngere Generation erkennt ganz schnell, ob es sich lohnt, weiter zuzuschauen oder man lieber gleich weiter surft“, sagt Stutterheim auch mit Blick auf das Abspielen von Filmen auf Tablets. Dennoch glaubt sie, dass der Kern eines guten Films noch immer die gute Geschichte sei, daran habe sich in etlichen Tausend Jahren, in denen Geschichten erzählt werden, nichts geändert. Schon Kafka habe formuliert: „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“
Richard Rabensaat
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: