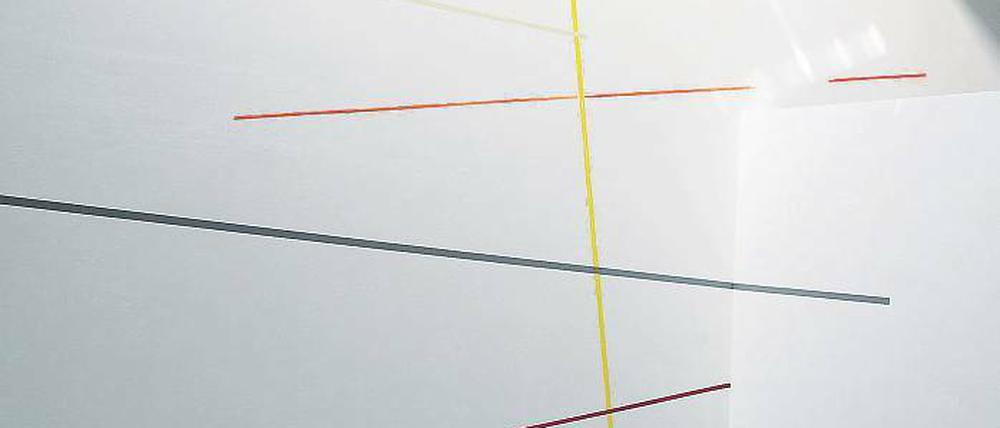
© Manfred Thomas
Kultur: Fadenwürmer und rechte Winkel
Das KunstHaus Potsdam thematisiert Linie und Strich
Stand:
Nur die „einfache Linie“ konnte für Annette Jahnhorst das Thema sein. Einer Kunst frei von Bezügen auf Figur oder Gegenstand gelte ihre Vorliebe, erklärt die Kuratorin. Im Kunsthaus Potsdam zeigt die Kunsthistorikerin mit einer ganz persönlichen Ausstellung die Vielgestaltigkeit, die sich hinter einem einfachen Strich verbergen kann. Annette Jahnhorst beweist, dass die Konzentration auf ein einzelnes Element dennoch ein breites Spielfeld an künstlerischen Möglichkeiten eröffnen kann.
Aus hartem Eichenholz ist der sonderbar verschlungene Knoten von Michael Dudowitsch gefertigt. Mit einer Ausdehnung von mehr als einem Meter Höhe und einer Breite von knapp einem halben Meter reckt er seinen schmalen, lang auslaufenden Pfahl in die Höhe. Wie kribbelige Insekten laufen die dünnen Drahgestelle von Brigitte Schwacke über die Wände. Merkwürdig lakonisch baumeln verschlungene Eisengebilde von Ursula Sax an der Wand. Frei von gegenständlichen Assoziationen sind sie jedoch nicht: Ein Fadenwurm, ein Wiesel, das sich aus seiner Höhle den Weg ans Tageslicht gräbt? Der Reiz der Objekte liegt in ihrer Vieldeutigkeit.
Jahnhorst weist darauf hin, dass die Zeichnung und mit ihr auch die Linie als eigenständiges künstlerisches Moment lange zu Unrecht ein Schattendasein geführt habe. Erst seit knapp einem Jahrhundert sei die Zeichnung als eigene Ausdrucksform anerkannt. Eingedenk der Studien Da Vincis zu Haartracht und Naturphänomenen stimmt das nicht so ganz.
Aber wenn auch die Zeichnung schon immer zum Handwerkszeug bildender Künstler gehörte, so erkennt doch erst die Moderne ihren eigenständigen Wert als fiebrigen Gradmesser von Psyche und Zeitgeist. Welche eigenständige Kraft im Schwung der Linie liegt, demonstrieren die Expressionisten. Nervöse Zeichnungen Ernst-Ludwig Kirchners künden von hektischem Großstadtleben. Hart konturierte Figuren von Max Beckmann verleihen einer von Mythen durchdrungenen Bildwelt Bedeutungsschwere. Die Kubisten nutzen den Strich zur Zergliederung des Bildraumes und dekonstruierten eine Welt, die in zwei Weltkriegen auseinanderzubrechen drohte. Maler wie Wols finden nach dem zweiten Weltkrieg in ihren Tafelbildern zu skripturalen Formen, die nicht minder zerrissen erscheinen.
„Alles im Fluß“ betitelt Helga Geng ihre wuselige, vielfarbige Zeichnung. Das Blatt ist 2010 entstanden und zeigt nicht die Zersplitterung der Welt, sondern versprüht quirlige Lebendigkeit. „Raum konkret“ von Rudolf Valenta dagegen beschränkt sich dem Titel entsprechend auf die kollagierte Konstruktion eines verwinkelten Raumes, der sich selbst genügt, auf nichts anderes verweisen möchte und dabei doch eine bemerkenswerte Stimmigkeit erreicht.
Ausgesprochen sparsam kommt dagegen Norbert Krickes Skulptur „Raumplastik Weiß“ daher. Einen etwa einen Meter langen weißen Stahldraht hat der 1984 verstorbene Professor für Bildhauerei zu einer Skulptur gebogen. Geschützt in einer Glasvitrine steht das feingliedrige, 40 000 Euro teure Objekt wohl platziert im Raum. Ein Privatsammler hat es für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Das „freie geistige Spiel“ und „den Dialog“ lobte Kricke als den Kern künstlerischer Arbeit. Wie lebendig ein solcher Dialog auch bei äußerster Reduktion auf die schlichte Dualität von „Strich und Faden“ sein kann, zeigt die Ausstellung. Ob ein vierfach rechtwinklig gebogener Draht ebenfalls entsprechende diskursive Qualitäten aufweist, mag der jeweilige Betrachter entscheiden.
„Nach Strich und Faden – die Linie in der Kunst der Gegenwart“ noch bis zum 16. Oktober, mittwochs von 11-18 Uhr, donnerstags und freitags von 15-18 Uhr und samstags und sonntags von 12-17 Uhr in Kunstverein KunstHaus, Ulanenweg 9
Richard Rabensaat
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: