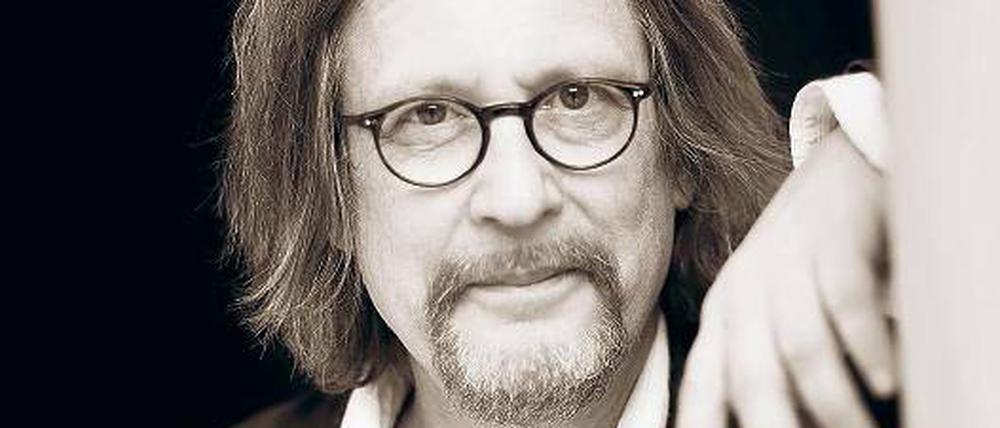
© Bertelsmann Verlag
ZUR PERSON: „Wutkolumnen schreibe ich sehr, sehr gern“
Am Samstag liest Harald Martenstein in Potsdam – Ein Gespräch über das Banale und klassische Liebessituationen
Stand:
Herr Martenstein, lassen Sie uns im Plauderton beginnen. Denn die Erfahrung hat mich gelehrt, dass Autoren und Schriftsteller, die bekannt und geschätzt sind für ihre humorvollen Texte, sich im Interview nicht selten als äußerst schwierig entpuppen können.
Oder als richtige Biester.
Ja, so musste ich einmal ein geplantes Interview mit dem Schriftsteller und Kolumnisten Harry Rowohlt schon nach wenigen Minuten abbrechen. Herr Rowohlt, äußerst übellaunig, wollte einfach nicht, klagte dann sogar über Zahnschmerzen.
Der ganze Humor, den wir besitzen, fließt in die Texte. Da bleibt für die gesprochene Sprache nichts übrig.
Vielleicht liegt es aber auch an den Fragen, von denen wir Journalisten glauben, dass sie doch äußerst originell sein müssen. Der Interviewte aber innerlich nur aufstöhnt und denkt: Oh nein, nicht das schon wieder. So muss es Ihnen doch auch gehen, wenn Sie mal wieder gefragt werden: Herr Martenstein, wie schreibt man eine gute Kolumne?
Das ist eine schwierige Frage, die mir komischerweise noch gar nicht oft gestellt wurde.
Dann warten wir jetzt auf die Antwort.
Ich glaube, man darf sich nicht allzu sehr verstellen. Die Kolumne ist ja eine sehr persönliche Form und darum sollte man beim Schreiben versuchen, derjenige zu sein, der man ist. Das etwas vernutzte Wort dafür ist ja „authentisch“. Wenn man also nah bei sich ist, erkennen sich auch andere Leute in den Texten wieder.
Klingt fast zu einfach, um wirklich wahr zu sein.
Aber wir sind alle nicht besonders oder originell. Die Leute sind sich ja ähnlicher, als man denkt.
Vielleicht liegt aber gerade die größte Schwierigkeit im Nah-bei-sich-sein, also darin, einen eigenen Ton zu finden?
Die Leute erwarten natürlich einen eigenen Ton, den sie mögen. Andererseits will aber kein Mensch immer das Gleiche haben. Das ist das Grundproblem, mit dem man es als Kolumnist zu tun hat: Einerseits immer das Gleiche und andererseits jede Woche etwas anderes zu liefern.
Und wie überwinden Sie diesen Grundwiderspruch seit nunmehr acht Jahren jede Woche aufs Neue mit Ihrer „Zeit“-Kolumne?
Ich versuche, mir so eine Art Kommode mit mehreren Schubladen zu zimmern, von denen ich in den verschiedenen Wochen immer eine andere aufziehe. So ist die Kolumne ja auch nicht immer lustig. Wenn ich mal in einer melancholischen Stimmung bin oder übellaunig, dann schreibe ich auch etwas Melancholisches oder Übellauniges. Ich habe da so vier bis fünf Grundmelodien.
Grundmelodien?
Da ist die Klage über die Plagen des Alterns und über das Verstreichen der Zeit. Dann die Wut über irgendwelche Zumutungen des modernen Lebens. Solche Wutkolumnen schreibe ich übrigens sehr, sehr gern. Dann schreibe ich auch mal über meine Rolle als Vater. Manchmal schreibe ich auch über ein Produkt, das Ärger macht, beispielsweise über einen Anrufbeantworter. Denn vor acht Jahren hat das alles ja als Verbraucherkolumne begonnen, ich sollte über Verbraucherprobleme schreiben. Zwischen diesen Grundmelodien wechsle ich dann, um Monotonie zu vermeiden.
Aber provokant darf es gelegentlich auch sein?
Ja, wichtig ist, dass man bestimmte Regeln der politischen Korrektheit – auch wieder so ein Schlagwort – nicht zu ernst nimmt. Es ist immer ganz schön, sich im Grenzbereich des gerade noch Erlaubten zu bewegen. Sätze, von denen ich denke, dass die „Zeit“ sie gerade eben noch druckt. Das merkt der Leser natürlich auch.
Was den Leser Ihrer Kolumne aber auch immer wieder überrascht, sind Themen wie beispielsweise die Toiletten in den Zügen der Deutschen Bahn oder Ihre Abenteuer in Ihrem Garten, wo Sie mal Mücken jagen oder Nacktschnecken mit Zahnstochern meucheln. Und wieder ist man erstaunt, wie unterhaltsam diese eigentlich doch sehr banalen Themen sind.
Zugegeben, das ist jetzt ein banaler Satz, aber unser Leben besteht nun mal zum großen Teil aus Banalitäten, angefangen mit dem Zähneputzen am Morgen. Wenn wir das, was wirklich mal bedeutsam oder besonders ist in unserem Leben, zusammenrechnen, da kommen wir nicht auf mehr als eine halbe Stunde am Tag.
Das klingt nun sehr ernüchternd. Aber in Ihren Kolumnen verleihen Sie diesem Banalen zumindest einen gewissen Glanz. Wie viel Persönliches lassen Sie eigentlich in diesen Texten zu?
Schon relativ viel. Ich erzähle immer eine wahre Geschichte, die ich vielleicht gelegentlich etwas ausschmücke oder an deren Ende ich etwas wegschneide. Aber wie schon gesagt, würde da nicht so viel von mir drinstecken, würde es nicht funktionieren.
Also gehört zum Kolumnenschreiben auch ein gewisser Hang zum Exhibitionismus?
Zumindest die Bereitschaft, etwas von sich herzugeben und rauszulassen. Das führt dann gelegentlich auch zu dem Vorwurf, dass ich eitel sei. Was aber auch kein ganz unzutreffender Vorwurf ist.
Dann sind Sie also auch, wie vor zwei Wochen in Ihrer Kolumne zu lesen war, ein halbes Jahr barfuß durchs Leben gegangen?
Diese Kolumne ist von allen, die ich bisher geschrieben habe, die am häufigsten missverstandene. Das war eine Parodie auf die vielen Sachbücher, die in den letzten Jahren erschienen sind und Titel tragen wie „Ein halbes Jahr ohne Internet“. Da steht immer das Gleiche drin: Man kann auch ohne leben! Es ist aber schwer! Manche Dinge kann man dann nicht mehr machen! Von vielen Leuten wird man für verrückt gehalten! Ich wollte mit der Kolumne zeigen, dass man ein solches Sachbuch zu jedem Thema der Welt schreiben kann, auch, ohne es wirklich zu machen. Ich dachte, das sei deutlich als Parodie erkennbar gewesen.
Aber vielleicht traut man es Harald Martenstein mittlerweile zu, ein halbes Jahr lang auf jegliches Schuhwerk zu verzichten?
Meinen Füßen ist das jedenfalls nicht zuzutrauen.
Wenn Sie am Samstag unter dem Motto „Altes und Neues vom Martenstein“ in der Villa Quandt lesen, wird es nicht nur um Ihre Kolumnen gehen. Sie werden auch Ihren zweiten Roman „Gefühlte Nähe“ vorstellen, der in der kommenden Woche erscheint. Darin geht es um 23 Männer, die eines gemeinsam haben: dieselbe Frau. Das klingt etwas verwirrend.
Das ist auf der einen Seite die Lebensgeschichte einer Frau, geschildert von den 23 Männern, mit denen sie im Laufe ihres Lebens zusammen ist. In Wirklichkeit ist es aber natürlich ein Buch über die Männer, die man in verschiedenen, klassischen Liebessituationen erlebt. Jedes Kapitel behandelt so auch eine Grundsituation des Liebeslebens. Sich verlieben, verlassen, verlassen werden, betrügen, betrogen werden, das erste Mal, das letzte Mal und was es da noch alles gibt. Das Buch ist eine Liebesbiografie.
Warum haben Sie mit „Gefühlte Nähe“ auf das bewährte Romanthema „Liebe“ gesetzt?
Weil die Romanthemen immer gleich sind. Das Leben besteht nun einmal aus Grundzutaten wie Geburt, Liebe, Partnerschaft, Kinder, Krankheit und Tod. Das ist alles. Darum kann man gar nichts anderes tun, als sich immer wieder auf diesem Feld zu bewegen.
Und warum ausgerechnet unterschiedliche Liebesphasen anhand von 23 Männern?
Ich wollte eine neue Form von Biografie schreiben. Die Idee hatte ich schon vor ein paar Jahren, als meine Großeltern gestorben sind. Die waren noch 60 Jahre verheiratet. Das ist etwas, das es heute kaum noch gibt. Die meisten Biografien, zumindest bei uns in der Großstadt, sind geprägt durch das, was man serielle Monogamie nennt. Wir denken immer wieder, es hält für ewig, aber in den meisten Fällen passiert das nicht. Man teilt sein Leben einige Jahre mit diesem Menschen, dann eine kurze Zeit mit jenem und dann wieder mit einem anderen. Am Ende steht am Grab eine imaginäre Gesellschaft von fünf, zehn oder auch 20 Witwen oder Witwern. Ich wollte über diese neue, sozusagen halbnahe Nähe zwischen Menschen schreiben, die entsteht, wenn man befristet zusammen ist.
Ganz unter uns: Und wie kommen wir Männer in „Gefühlte Nähe“ weg?
Sehr gemischt. Es gibt einige richtige Schweine darunter, aber auch einige sehr bemitleidenswerte Exemplare.
Das Gespräch führte Dirk Becker
Harald Martenstein liest unter dem Motto „Altes und Neues vom Martenstein“ am Samstag, dem 28. August, um 18 Uhr in der Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro. Reservierung unter Tel.: (0331) 280 41 03
Harald Martenstein, 1953 in Mainz geboren, studierte Romanistik und Geschichte in Freiburg. Seine journalistische Karriere begann er 1981 als Redakteur der Stuttgarter Zeitung.
Heute schreibt Martenstein regelmäßig Kolumnen in der Wochenzeitung „Die Zeit“ und im Tagesspiegel. Für eine Reportage über den Erbstreit im Suhrkamp-Verlag erhielt er 2004 den Egon-Erwin-Kisch-Preis.
2007 erschien sein erster Roman „Heimweg“, der mit dem CORINE-Debutpreis geehrt wurde. In Kürze erscheint Martensteins neuer Roman „Gefühlte Nähe“. kip
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: