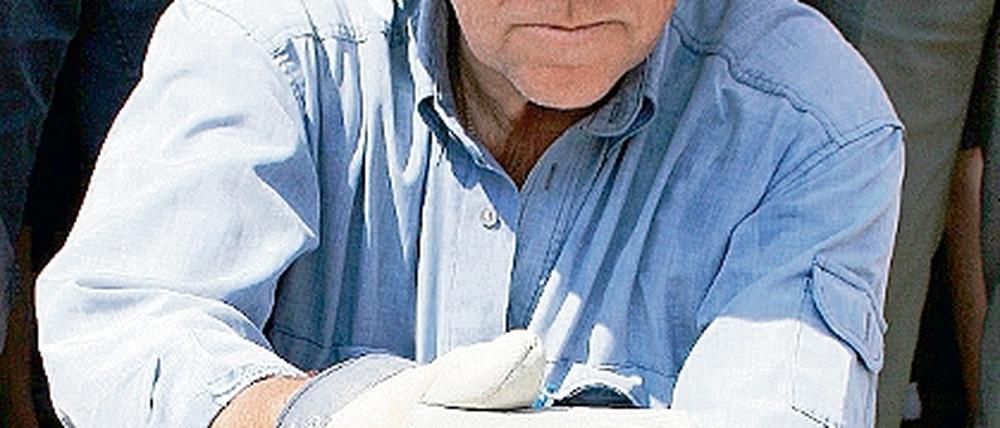
© Klaer
Von Henry Klix und Kirsten Graulich: Die Schaufenster zerschlagen
Rathaus und Toleranz-Bündnis Kurage bereiten Stolperstein-Verlegung in Werder vor
Stand:
Werder (Havel) - Mamortischplatte: 60 Reichsmark. Neue Sperrholztür für das Schlafzimmer: 38 Reichsmark. Zwei silberne Leuchter zerschlagen: 120 Reichsmark. Kristallspiegel: 25 Reichsmark. Akribisch hat das Werderaner Stadtbauamt nach der Pogromnacht im November 1938 die Schäden auflisten lassen, die im Haus des jüdischen Hausbesitzers Walter Gutsmann am Schwalbenberg 27 in Werder entstanden sind. 96 Positionen umfasst die Liste, der Gesamtschaden wird auf 2144,55 Reichsmark beziffert. Die Schäden bei Eduard Gelhar in der Lehmannstraße (heute Bernhard-Kellermann-Straße) werden auf 1346,73 Reichsmark geschätzt, bei Max Jacob auf 887,65 Reichsmark. „Die von Jacob angemeldeten Schäden in Glas, Porzellan, Ton und Emaillewaren konnten nicht mehr abgeschätzt werden, da Jacob die angeblich zerschlagenen Gegenstände schon beseitigt haben will“, heißt es unter der vom Stadtbauinspektor und dem „Ortsbeauftragten des Handwerks“ unterzeichneten Aufstellung.
Die insgesamt acht jeweils mit Namen und Anschriften versehenen Listen des Stadtbauamtes zur „Feststellung der Schäden bei den Judengrundstücken innerhalb des Gemeindebezirks Werder“ sind die wichtigsten Dokumente, die über die Nacht vom 9. zum 10. November in Werder existieren. Sie sollen dabei helfen, wenn es jetzt darum geht, an die Opfer des Nationalsozialismus in Werder zu erinnern, wie Bürgermeister Werner Große (CDU) den PNN sagte. Die Stadt will sich an der Aktion „Stolpersteine“ des Kölner Künstlers Gunter Demnig beteiligen: Vor dem jeweils letzten freiwillig gewählten Wohnort von Opfern der NS-Diktatur sollen die kleinen beschrifteten Messingsteine im Pflaster die Erinnerung an diese Menschen bewahren. Rund 20 000 Stolpersteine hat Demnig weltweit bereits verlegt.
Die acht Namen hat das Rathaus Werder inzwischen an die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geschickt – in der Hoffnung, dass sie mit dem umfangreichen Museumsarchiv abgeglichen werden können und sich die Schicksale zurückverfolgen lassen. Zudem wird sich die Carl-von-Ossietzky-Oberschule im nächsten Schuljahr in einem Schulprojekt mit den Geschehnissen befassen, sagte Große.
Auch auf anderer Ebene wird derzeit für das Stolperstein-Projekt geforscht: Am Dienstagabend war der bekannte Ortschronist Baldur Martin bei einem Gesprächsabend des Werderaner Toleranz-Bündnisses Kurage. Martin erinnerte an einen Brief des Berliners Klaus-Günter Grothe im Juni 2005 an das Rathaus: Grothe hatte angefragt, einen Stolperstein für Hans-Peter Olschewski verlegen zu lassen. Er würde für die Kosten aufkommen, schrieb der 84-Jährige, der ein Klassenfoto beilegte, auf dem auch der damals 15-jährige Olschewski abgebildet ist. Beide hatten die Mittelschule in Werder besucht, doch nach der Pogromnacht im November 1938 blieb die Bank neben Grothe leer. Kaufmann Kurt Olschowski taucht auch in der städtischen Schadensliste auf, die Rollläden wurden in der Pogromnacht durch „Axthiebe“ beschädigt, die beiden Schaufenster zerschlagen. Laut Baldur Martin wollte sich seinerzeit niemand den Hut aufsetzen, um die Sache voranzutreiben und in den Archiven zu forschen. „In alteingesessenen Familien der Stadt wird nicht über diese Ereignisse geredet.“
Jetzt will sich Kurage an den Forschungen beteiligen. Kuragemitglied und SPD-Ortschefin Anja Spiegel will im Berliner SPD-Archiv recherchieren. Auch das Gedenkbuch des Bundesarchivs gibt nach PNN-Recherchen Auskunft über jüdische Namen aus Werder, einige decken sich mit denen aus dem Stadtarchiv.
Werner Joseph Fleck sowie Käte und Kurt Jacob wurden in Auschwitz ermordet. Die in Werder geborene Emilie Asch starb am 17. Januar 1944 im Ghetto Theresienstadt. Dorthin wurde im Juli 1942 auch Berta Mautner deportiert, die zuletzt in Werder wohnte und im Oktober 1942 im Vernichtungslager Treblinka starb. Von Elsa Kohlmann ist bekannt, dass sie am 11. Februar 1943 starb. Sie war mit der Malerin Charlotte Rosenthal befreundet, von der das Datum der Deportation bekannt ist: 14. April 1942, Warschau. Von dort kam sie ins Zwangsarbeitslager Trawniki bei Lublin, wo sie ermordet wurde. Auch das Ehepaar Helene und Walter Johann Guttsmann wurde am 28. März 1942 in das Ghetto Piaski deportiert.
Über neun weitere Opfer aus Glindow gibt das Gedenkbuch ebenfalls Auskunft.
Wer Informationen zum Schicksal von Opfern der Hitler-Diktatur in Werder beisteuern kann, kann sich an das Bürgermeisterbüro im Rathaus wenden. Telefon: (03327) 783 270.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: