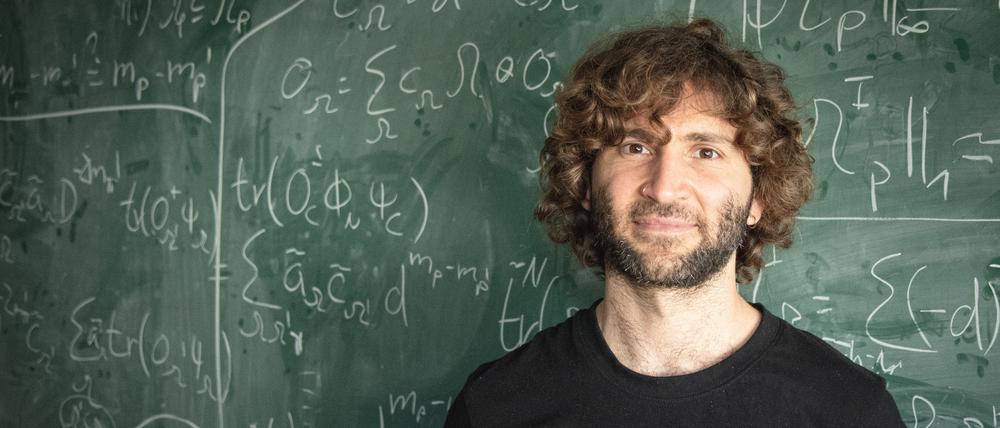
© Marion Kuka
Mathematik an der Freien Universität: Wie nachhaltig sind Quantencomputer?
Der Versuch, Unmöglichkeitsergebnisse zu beweisen: Der Mathematiker Ryan Sweke erforscht Algorithmen für die Super-Rechner.
Stand:
Ryan Sweke läuft zügig durch das Labyrinth des Physikgebäudes der Freien Universität Berlin. Er kennt sich aus. Bevor er zum Tech-Riesen IBM nach Kalifornien ging, war er Postdoc in der Arbeitsgruppe des Quantenforschers Jens Eisert. Nun ist Ryan Sweke zurück in Berlin: Anfang des Jahres wurde er auf den Deutschen Forschungslehrstuhl am African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in seiner Heimat Kapstadt, Südafrika, berufen.
Die Alexander von Humboldt-Stiftung finanziert mehrere solcher Stellen an AIMS-Zentren in afrikanischen Ländern, und die Inhaberinnen und Inhaber verbringen jedes Jahr einige Wochen an ihren deutschen Partneruniversitäten. Für Ryan Sweke heißt das: an der Freien Universität.
„Die Stelle ist genau das, was ich schon immer wollte“, sagt Ryan Sweke. Das AIMS-Institut habe ihn bereits als Student inspiriert, als er dort auf einem Workshop zum ersten Mal mit Quantencomputing in Berührung kam. Die Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen Arbeitsgruppe ist ein weiterer Pluspunkt. „Und Berlin im Sommer sowieso“, fügt er hinzu.
Die Labore mit komplizierten experimentellen Aufbauten und Laserwarnschildern lässt er links liegen. Sein Arbeitsplatz: ein Raum mit großen Kreidetafeln, dicht beschrieben mit Formeln, und einem Laptop. Der promovierte Mathematiker entwirft Algorithmen für Quantencomputer, obwohl deren Hardware bisher mehr schlecht als recht funktioniert.
Dennoch gelten sie weltweit als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Quantencomputer basieren auf den Gesetzen der Quantenmechanik, die beschreiben, wie sich kleinste Teilchen, etwa Atome und Elektronen, verhalten und miteinander interagieren. Während Objekte in der klassischen Physik immer nur einen bestimmten Zustand annehmen, können die winzigen Quantenobjekte sich gleichzeitig in mehreren Zuständen befinden und über große Entfernungen miteinander verbunden sein – ein Phänomen, das als Verschränkung bekannt ist.
Grenzen der heutigen Geräte
Die Idee, einzelne Atome oder Ionen als Recheneinheiten zu verwenden, hatten der russisch-deutsche Mathematiker Yuri Manin, später Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn, und der US-Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman unabhängig voneinander schon in den 1980-er Jahren: Sie erkannten, dass Quantensysteme besser mit einer Hardware simuliert werden könnten, die selbst auf Quantenphänomenen basiert.
Während solche Rechner bis vor Kurzem noch Zukunftsmusik waren, gibt es nun erste Maschinen mit Hunderten von Recheneinheiten. Noch sind sie wahre Mimosen: Bei kleinsten Störeinflüssen aus der Umgebung verschwinden die Quantenvorteile, also die Eigenschaften, die sie rechnerisch so mächtig machen.
„Vollständig fehlertolerante Exemplare existieren noch nicht“, sagt Ryan Sweke. Deshalb werde einerseits erforscht, was fehlertolerante Geräte künftig leisten könnten, andererseits, was mit den kleinen, verrauschten und unvollkommenen Maschinen von heute möglich ist.
Ein großer Teil meiner Arbeit richtet sich darauf, mathematisch streng zu beweisen, wo die Grenzen der heutigen Geräte liegen.
Ryan Sweke, Mathematiker
„Ein großer Teil meiner Arbeit richtet sich darauf, mathematisch streng zu beweisen, wo die Grenzen der heutigen Geräte liegen“, erklärt der Wissenschaftler. Dabei zerstört er so manche Illusion: Für eine Aufgabe könne man entweder schnellere Algorithmen entwickeln oder beweisen, dass es keine schnelleren gibt. Ihn interessiert besonders Letzteres: Unmöglichkeitsergebnisse zu beweisen.
Wann es einen hochleistungsfähigen Quantenrechner geben wird, ist unklar. Weltweit ringen private Unternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen um die beste Hardware. Supraleitende Qubits, Ionenfallen, photonische Systeme – jeder Ansatz punktet anders, sei es bei Skalierbarkeit oder Präzision.
Ryan Swekes Algorithmen bleiben davon unberührt: Sie funktionieren auf allen Plattformen. „Andere übersetzen die Befehle in Anweisungen, die die Maschine versteht“, erklärt der Mathematiker, der auch erforscht, wie maschinelles Lernen durch Quantencomputer verbessert werden kann.
Neue Materialien
Können Quantencomputer uns auch dabei helfen, nachhaltig zu leben oder gar den Klimawandel zu stoppen? Zum Beispiel einfach ausrechnen, wie und wo wir Emissionen senken können, ohne Wirtschaft und Haushalte stark zu belasten? „Solche Optimierungsprobleme bezeichnen wir in der Mathematik als ‚unstrukturiert NP-schwer“, erklärt Ryan Sweke. Grundsätzlich lassen sie sich sowohl mit klassischen als auch mit Quanten-Algorithmen lösen – nur eben sehr, sehr langsam. Und: Für diese Art von Aufgaben bieten Quantencomputer keinen nennenswerten Geschwindigkeitsvorteil.
Quantencomputer basieren auf der Quantenmechanik, die beschreibt, wie sich kleinste Teilchen verhalten.
Ryan Sweke, Mathematiker
Hoffnung gebe es aber für die Materialforschung. So gehe es etwa bei der Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern genau darum, Quanteneffekte zu verstehen und zu nutzen. Das Potenzial ist enorm: In normalen Kabeln entsteht durch elektrischen Widerstand Wärme, wodurch große Mengen an Energie verloren gehen. Supraleiter dagegen leiten Strom ohne Widerstand, bislang aber nur bei sehr tiefen Temperaturen. Würde man ein Material finden, das Strom bei Raumtemperatur leiten kann, ließe sich dieser verlustfrei übertragen – ein enormer Effizienzgewinn.
Auch für die CO₂-Abscheidung gibt es Ansätze: Gesucht werden Materialien, die wie ein Schwamm Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen können. Dafür brauchen sie eine extrem große Oberfläche und gleichzeitig eine starke Bindung ans CO₂– eine schwierige Kombination. Quantenrechner könnten helfen, solche Materialien schneller zu identifizieren.
In der Praxis wird die Arbeit mit Quanten- und klassischen Computern wohl Hand in Hand gehen, vermutet Ryan Sweke – jeder Rechner löst die Aufgaben, die er am besten beherrscht. Beispielsweise schlägt der klassische Computer Moleküle für neue medizinische Wirkstoffe vor, während der Quantenrechner prüft, ob ein Wirkstoff die gewollte Eigenschaft besitzt.
Zugang für alle
Ob die neue Technologie selbst einmal energieeffizient arbeiten wird, bleibt ungewiss. Ryan Sweke hofft, dass die Branche aus dem Debakel mit der Künstlichen Intelligenz lernt: In den USA hat der enorme Energiehunger von KI-Datenzentren einen Atomkraft-Boom ausgelöst. Stillgelegte Reaktoren werden wieder in Betrieb genommen, und neue, kleine Atomreaktoren werden eigens für Rechenzentren gebaut. Der Forscher wünscht sich eine kritische Öffentlichkeit und staatliche Regeln, um bei Quantencomputern ähnliche Fehler zu verhindern.
Natürlich seien Quantencomputer eine „Dual Use“-Technologie, betont Sweke – für gute wie für schädliche Zweck einsetzbar – und könnten auch zur Entwicklung neuer Waffen dienen. Eine Gefahr für Missbrauch sieht er vor allem bei Ungleichheit: Hat nur eine bestimmte Gruppe Zugang zu einer solchen Technologie, kann es gefährlich werden. Ist der Zugang offen für alle, steigen die Chancen, das Leben vieler Menschen damit zu verbessern.
Auch deshalb hat sich Ryan Sweke für das African Institute for Mathematical Sciences als Arbeitgeber entschieden. Im nächsten Jahr wird ihn eine Gruppe junger Mathematikerinnen und Mathematiker aus Südafrika nach Berlin begleiten und sich an der Forschung beteiligen.
Zwar entstehen durch die Flüge Emissionen, doch während europäische Forschende auch ohne Langstreckenflüge miteinander in den karrierefördernden Austausch gehen können, sind ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem globalen Süden auf lange Reisen angewiesen. „Das lässt sich nicht vermeiden, wenn Chancen gerecht verteilt werden sollen“, sagt Ryan Sweke.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: