
© AKG-images
Karl Winnacker: Ehrung mit Schatten
An den I.G.-Farben-Manager Karl Winnacker erinnern heute mehrere Preise. Dabei war er in den Nationalsozialismus verstrickt.
Stand:
Die I.G. Farben und der NS-Staat – sie waren zwei Seiten einer Medaille. Der riesige Konzern, 1925 aus den drei größten europäischen Chemieunternehmen BASF, Bayer und Hoechst hervorgegangen, half Hitler mit einer üppigen Wahlkampfspende an die Macht zu kommen und verband sich danach immer enger mit dem Regime, wurde nahezu zu einem Staatsunternehmen: Fast alle seiner Direktoren waren Mitglied der NSDAP. Der Aufsichtsratsvorsitzende Carl Krauch, bei den Nürnberger Prozessen wegen Versklavung von KZ-Häftlingen verurteilt, fungierte zugleich in Hitlers Regierung als Direktor der rüstungswirtschaftlichen Kommandozentrale und Bevollmächtigter für Sonderfragen der chemischen Produktion. Auch andere I.G.-Angehörige arbeiteten in Hitlers Vierjahresplanbehörde, die Deutschland auf den Krieg vorbereitete. Die I.G. Farben waren nicht nur der wirtschaftliche Motor Nazi-Deutschlands, sie unterstützten das Regime auch, indem sie zahlreiche kriegswichtige Produkte herstellten, darunter Munition, den Nervenkampfstoff Tabun oder synthetisches Benzin.
Um die Produktion in Schwung zu halten, griff das Unternehmen massenhaft auf Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge zurück. Von ihnen wurden allein Zehntausende durch Arbeit in Auschwitz vernichtet. Dort hatten die I.G. Farben von 1941 an ein großes Werk zur Herstellung synthetischen Kautschuks (Buna) von KZ-Häftlingen bauen lassen, für die eigens das Lager Buna (bald „Auschwitz-Monowitz“ genannt) errichtet wurde. Tausende geschwächter Arbeiter wurden von den SS-Ärzten in die Gaskammern von Auschwitz-Birkenau geschickt. Das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B für ihre Vernichtung lieferte Degesch, eine Tochter der IG Farben und der Degussa. Kein Unternehmen hat sich so wirkungsvoll wie die IG Farben „in den Dienst des nationalsozialistischen Programms der Aufrüstung, Autarkie, Aggression und Ausrottung“ gestellt, hat der amerikanische Holocaust-Forscher Peter Hayes formuliert.
In Deutschland findet man trotzdem nicht viel dabei, einem einstigen Direktor der I.G. Farben ein ehrendes Andenken zu bewahren. Nach Karl Winnacker, während des Nationalsozialismus einer der beiden mächtigsten Männer bei Hoechst, einer Hauptsäule der I.G. Farben, sind bis heute drei Preise in der Wissenschaft sowie ein Institut benannt.
Der Marburger Universitätsbund vergibt einen „Karl-Winnacker-Preis“, um damit seines langjährigen Vorsitzenden zu gedenken. Das Deutsche Atomforum, ein Interessenverband der Atomindustrie, hat einen „Karl-Winnacker-Preis“ ausgelobt, denn Winnacker hat sich nach dem Krieg für Atomkraft engagiert. Auch ein Institut trägt Winnackers Namen: Das Karl-Winnacker-Institut der Dechema, einer Fachgesellschaft für die chemische Forschung. Das mit 37 500 Euro dotierte Karl-Winnacker-Dozentenstipendium der Aventis Foundation, das der Fonds der Chemischen Industrie beim Verband der Chemischen Industrie (VCI) jedes Jahr an Nachwuchschemiker für besondere wissenschaftliche Leistungen vergibt, ging im April an den 34-jährigen Chemiker Christian Hackenberger von der FU.
Taugt ein Preis mit diesem Namen wirklich als Auszeichnung für einen deutschen Chemiker? Winnacker hat Hoechst nach dem Krieg als langjähriger Vorstandsvorsitzender zu großen Erfolgen geführt. Doch vorher war er Rottenführer der SA und seit 1937 Mitglied der NSDAP. Schon durch seine Leitungsfunktion in den I.G. Farben war er in den Nationalsozialismus verstrickt. Und er war später keineswegs von Entsetzen und Reue gepeinigt, wie der Historiker Stephan H. Lindner, Professor an der Bundeswehruniversität München, feststellt, der die Geschichte von Hoechst im Auftrag des Unternehmens erforscht hat („Hoechst“, 2005).
Karl Winnacker (1903 – 1989), Vater des einstigen Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Ernst-Ludwig Winnacker, und des heute an der Universität Heidelberg forschenden Materialwissenschaftlers Albrecht Winnacker, trat im September 1933 nach seiner Chemie-Promotion in das I.G. Farbenwerk Hoechst ein und stieg dort schnell auf. Im Oktober 1943 wurde Winnacker Direktor und zugleich zum „zweitwichtigsten Mann“ des Unternehmens, denn er war „mit weit größerer Macht ausgestattet als ein gewöhnlicher Direktor des I.G. Werks“, wie Lindner schreibt. Hoechst produzierte für den Krieg nützliche Dinge, die oft auch zivil genutzt werden konnten: die Tarnfarbe für Autos, U-Boote und Flugzeuge, Spezialtreibgase für höhere Leistungen von Flugzeugen oder Feuerschutzmittel, Sprengstoffe und Nebelsäure. Außerdem stellte Hoechst Arzneien her, die zuvor von der SS an KZ-Häftlingen getestet wurden.
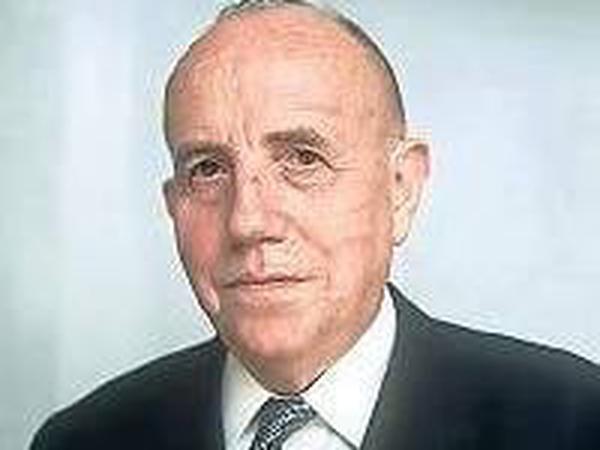
© picture-alliance / dpa
Wie überzeugt Winnacker von der Nazi-Ideologie war, vermag Lindner nicht zu sagen. Zwar habe Winnacker am Ende des Krieges bei einem Teil der Hoechst-Mitarbeiter „als besonders überzeugter Nationalsozialist“ gegolten. Aber er habe auch viele Widersacher gehabt: „Sicher verbürgt ist sein zupackendes Wesen, deutlich auch sein Mangel an Skrupel bei seiner Arbeit“, schreibt Lindner.
Nicht klären kann der Hoechst-Forscher auch, was Winnacker von Auschwitz wusste. Lindner geht davon aus, dass er 1943 dienstlich dort gewesen ist, vermutlich, um sich über die chemischen Potenziale der dort von Häftlingen geförderten Kohle zu informieren. Lindner zitiert Winnackers Sohn Albrecht, sein Vater habe sich mit der Auskunft seines Förderers und Vorgesetzten, des später bei den Nürnberger Prozessen verurteilten Fritz ter Meer zufrieden gegeben: „Was in Auschwitz geschieht, wollen Sie nicht wissen.“ Lindner verweist aber auch auf die Aussage des Zeugen Benedikt Kautsky im Wollheim-Prozess, wo 1953 über die Entschädigung der Zwangsarbeiter verhandelt wurde: „Dass ein Mensch, der mit offenen Augen durch das Gelände in Buna gegangen ist, die Dinge sehen musste, wenn er sie sehen wollte, das steht für mich fest, und wenn er sie nicht sehen wollte, so musste er sie riechen.“
Bescheid wusste Winnacker ganz sicher über die im Krieg insgesamt 8000 bei Höchst beschäftigten Zwangsarbeiter, die unterernährt in einem werkseigenen Lager hausten. Denn zu Winnackers Aufgaben gehörte es laut Lindner, mit den NS-Behörden über die Zuteilung von Zwangsarbeitern zu verhandeln.
Winnacker hat nach dem Krieg erklärt, er habe nie ein Amt in der Partei oder in der Regierung innegehabt, sondern vielmehr seine ganze Kraft dafür eingesetzt, die „schwierige Lage“ von Hoechst zu verbessern. Dies ehre ihn, „es sei denn, dass man dem Soldaten zum Vorwurf machen wollte, wenn er bis zum Kapitulationsbefehl seine Pflicht getan hat“. Seinen Eintritt in die SA begründet er sogar mit der Haltung seines jüdischen Hochschullehrers Berl. Winnacker nennt ihn „unser Vorbild“, „ein Mensch der Ordnung mit streng nationalem Denken“: „Weder er noch wir hätten uns für die kommunistische Alternative entscheiden können. So schloß ich mich mit vielen anderen am Institut im Frühjahr 1933 der SA in Darmstadt an (...).“ Zu dieser Zeit bestand die „kommunistische Alternative“ aber schon nicht mehr, Hitler war an der Macht.
Nach dem Krieg gehörte Winnackers Solidarität den „,Opfern’ der Entnazifizierung, nicht den Opfern des NS-Regimes“, stellt Lindner fest. Winnacker, von den Engländern entnazifiziert, fasste bald wieder bei Hoechst Fuß. Schon 1951 wurde er in den Vorstand berufen, von 1952 bis 1969 war er Vorstandsvorsitzender, bis in die siebziger Jahre Aufsichtsratsvorsitzender.
Kaum hatte Winnacker sich nach dem Krieg fest im Vorstand etabliert, „ging er rasch dazu über, den ,Old Boys’ der alten I.G. zu helfen und ihnen möglichst im Hoechst Konzern eine Stelle zu beschaffen, egal wie politisch belastet sie waren“, schreibt Lindner. Die Bedenken der hessischen Landesregierung, Winnacker würde die „alte I.G. Clique“ zurückholen, hätten sich „als nur zu berechtigt“ erwiesen. Winnacker hatte sich jedoch bei Bundeskanzler Adenauer erkundigt, ob die in Nürnberg verurteilten Manager wieder in das Unternehmen eingebunden werden könnten. Adenauer zeigte sich für dieses Anliegen prinzipiell aufgeschlossen.
Lindner nennt in seiner Studie etwa ein Dutzend schwer belasteter Ex-I.G.’ler, die Winnacker in den fünfziger Jahren wieder auf hohe Posten ins Unternehmen zog, darunter in Nürnberg verurteilte Manager und mehrere SS-Mitglieder. Anderen verschaffte Winnacker zumindest großzügige Pensionen, um sie für die angeblich in den Nürnberger Prozessen erlittene Unbill zu entschädigen.
So versorgte Winnacker den ehemaligen I.G. Vorstand Max Ilgner, in Nürnberg zu drei Jahren Haft verurteilt, mit einer üppigen Pension. Winnacker schrieb an Ilgner: „Die moralische Haltung gegenüber den in Nürnberg Verurteilten ist für uns eine Selbstverständlichkeit.“ Winnacker versuchte sogar Walter Dürrfeld zu helfen. Dürrfeld hatte als führender unter drei Leitern der I.G. Auschwitz selbst die Selektion entkräfteter Häftlinge in die Gaskammern betrieben, wie Lindners Forschung zeigt. Winnacker wusste, dass Dürrfeld beim I.G.-Prozess in Nürnberg einer der beiden IG-Manager war, die zu den höchsten Strafen verurteilt worden waren.
Während Winnacker Tätern half, versuchte er die Entschädigung der I.G.-Opfer durch das Unternehmen zu verhindern, wie Lindner beschreibt: „Dass die I.G. Farben in Auschwitz zum Komplizen geworden war, die dafür eben auch haften musste, war und blieb ihm, aber nicht nur ihm, zeitlebens fremd.“ Die Frage, wie es den Zwangsarbeitern und Versuchsobjekten der I.G. ergangen war, habe sich Winnacker ebenfalls nicht gestellt.
Die deutsche Gesellschaft nahm daran nach dem Krieg kaum Anstoß. Die Spitzenmanager konnten ihre Zeit im Nationalsozialismus schnell abstreifen, ihre Leistungen in Wirtschaft und Wissenschaft waren wichtiger als Reue. So gründete die Hoechst AG 1959 die Karl-Winnacker-Stiftung „zu Ehren ihres damaligen Vorstandsvorsitzenden“ und begann, das Karl-Winnacker-Dozentenstipendium zu vergeben, das bislang über 80 Wissenschaftler bekommen haben, wie Eugen Müller von der Aventis-Foundation auf Anfrage mitteilt. Die Aventis-Foundation finanziert das Stipendium seit der Übernahme von Hoechst durch Aventis (inzwischen geschluckt von Sanofi).
Karl Winnacker gehörte nicht zu den 23 in Nürnberg angeklagten IG-Managern. Wie viele andere Mitglieder der Funktionseliten hat Winnacker aber nicht versucht, „Handlungsspielräume“ in der Diktatur zu nutzen, betont Lindner. Auch nach dem Krieg habe er kein schlechtes Gewissen gegenüber den von ihm angeforderten Zwangsarbeitern gehabt. Indem er I.G.-Manager, „die eklige braune Brühe“, ohne Zwang zurück ins Unternehmen holte und versuchte, die Entschädigung der Opfer zu behindern, habe er „aber Schuld auf sich geladen“, sagt Lindner.
Dieses haben die von Hoechst veranlassten Forschungen Lindners öffentlich gemacht. Eine Namensänderung des Stipendiums wäre aber ein „Etikettenschwindel“, findet Eugen Müller von der Aventis-Foundation. Auch sei nach Lindners viel beachtetem Buch zwar über „die Person und Rolle von Prof. Karl Winnacker“ „besonders intensiv“ diskutiert worden. Jedoch: „Dabei hat meines Wissens niemand gefordert, nun das Karl-Winnacker-Stipendium einzustellen.“
Der Holocaust-Forscher Michael Wildt, Professor an der Humboldt-Universität, fordert aber eben das: eine Umbenennung des Preises. Was für staatliche Institutionen gelte, solle auch für deutsche Unternehmen gelten. Sie sollten ihre nationalsozialistische Vergangenheit erforschen und aus den Ergebnissen auch öffentliche Konsequenzen ziehen: „Stiftungen wie Stipendien oder Preise nicht nach Belasteten, Mitwissern und Beteiligten zu benennen“.
Die Präsidentin der Universität Marburg, Katharina Krause, erklärt auf Anfrage, Winnacker habe sich in seiner Zeit als Vorsitzender des Marburger Universitätsbundes (1957 bis 1984) für die sozialen Belange der Studierenden eingesetzt. Um aber „ein neues Gesamtbild“ zu gewinnen, werde die Uni „die Persönlichkeit von Karl Winnacker im Licht der Publikation von Stephan Lindner sowie weiterer Unterlagen einer erneuten Bewertung unterziehen“.
Und wie sieht das der letzte Preisträger des renommierten Karl-Winnacker-Dozentenstipendiums? Würde sich der FU-Professor Hackenberger einen anderen Namen für den Preis wünschen? Hat er daran gedacht, den Preis angesichts der ihm inzwischen bekannt gemachten Forschungen von Lindner zurückzugeben? Hackenberger erklärt sich für nicht zuständig. Er teilt mit: „Als Nachwuchswissenschaftler, der für seine wissenschaftlichen Arbeiten während der Habilitation vom Fonds der Chemischen Industrie mit einem Dozentenstipendium ausgezeichnet worden ist, bin ich nicht in der Position, die Namensgebung des Preises zu diskutieren. Die Dachorganisation der deutschen Chemiker, die GDCh, ist dabei, ihre Historie im 3. Reich derzeit wissenschaftlich untersuchen zu lassen.“
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: