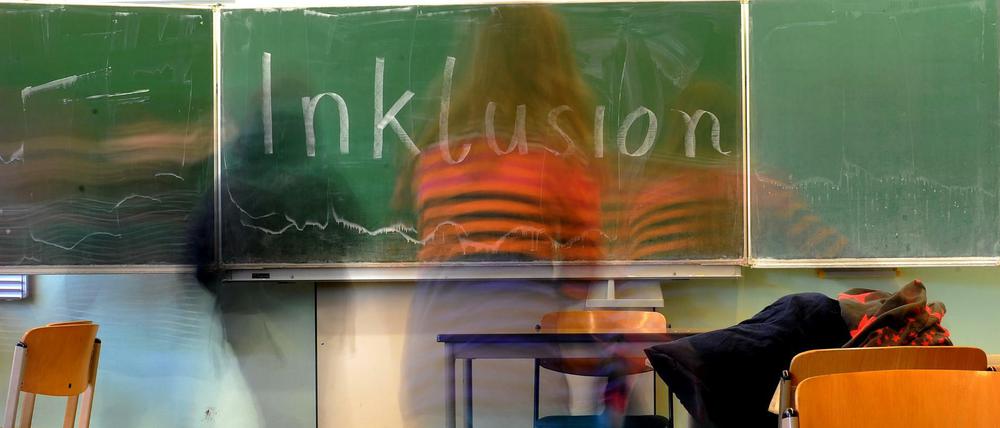
© Jonas Güttler/dpa
Langzeitstudie zu Erfolg und Misserfolg von Inklusion: Eltern spielen „entscheidende Rolle“
Seit fünfzehn Jahren müssen Europas Schulen „inklusiv“ sein und Kinder mit Förderbedarf integrieren. Nun legen Forschende die Ergebnisse einer fünfjährigen Untersuchung vor, ob Inklusion inzwischen funktioniert.
Stand:
Arne ist ein „GE-Kind“, Sophie hingegen „LE“ und bei Gustav hapert es an „SQ“. Inklusiv zu sein, ist für Schulen in Deutschland eine große pädagogische Herausforderung. Das wird schon an den vielen Abkürzungen deutlich, die Pädagogen für die verschiedenen Förderbedarfe von Schülerinnen und Schülern tagtäglich verwenden: Die einen haben Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ (GE) und sollen an jeder Regelschule ebenso gut lernen können wie Kinder mit Lern- (LE) oder Sprachdefiziten (SQ).
Schon seit 2011 ist Inklusion in der EU Pflicht. Eigentlich. Aber wie gut gelingt sie inzwischen an den Schulen? Jetzt zieht die Langzeitstudie „INSIDE“ erstmals Bilanz. Profitieren nur Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischen Förderbedarfen oder gewinnen alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen? Das bundesweite Forschungsprojekt „Inklusion in und nach der Sekundarstufe I in Deutschland“ (INSIDE) hat dazu fünf Jahre lang an 246 Schulen Daten über mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarfe erhoben und die Auswertung in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE) veröffentlicht.
„Wir wollten wissen, wie Inklusion in den Schulen praktisch umgesetzt wird“, so Amelie Labsch, Leiterin des INSIDE-Projekts vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Beteiligt waren außerdem das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen der Berliner Humboldt-Universität, die Bergische Universität Wuppertal und die Universität Potsdam.
Zusammenarbeit der Lehrkräfte entscheidend
Ziel der Studie war es zu erfahren, welche Bedingungen Inklusion fördern und welche Folgen das gemeinsame Lernen etwa für die schulischen Leistungen, das soziale Miteinander und den weiteren Bildungsweg hat. Dafür wurden sowohl die schulischen Rahmenbedingungen für Inklusion als auch die Gestaltung des inklusiven Unterrichts durch die Lehrkräfte beobachtet.
Ein Ergebnis: Von zentraler Bedeutung ist die Zusammenarbeit von allgemein- und sonderpädagogischen Lehrkräften. Darüber hinaus sind eine gute Unterrichtsvorbereitung, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und eine positive Arbeitsatmosphäre förderlich.

© dpa/Maurizio Gambarini
Doch wie wirkt sich Inklusion auf die Leistungen in Mathematik oder die Lesekompetenz der Lernenden aus? Die kurze Antwort: Positiv – zumindest zu Beginn der Sekundarstufe, also beim Übergang von Klasse sechs zu sieben. Sowohl bei der Lesekompetenz als auch in Mathe gewinnen alle Schülerinnen und Schüler dazu. Allerdings fällt Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf das Lernen etwas erwartungsgemäß schwerer.
Im Deutschunterricht werden inklusive Lehrprinzipien, die allen Schülerinnen und Schülern gerecht werden, den Studienergebnissen zufolge häufiger und erfolgreicher angewendet als im Mathematikunterricht. Das „Universal Design for Learning“ wirke sich in Mathematik sogar eher negativ auf den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler aus, habe die Auswertung „überraschend“ ergeben. Ob die Zusammensetzung der Klassen der Grund dafür ist oder ob in Klassen mit leistungsschwachen Schüler:innen das Lernniveau generell sinkt, sei unklar.
Die Rolle der Eltern
Auch Eltern spielen den Studienautor:innen zufolge eine entscheidende Rolle beim Bildungserfolg ihrer Kinder. Offenbar wirken sich vor allem die Kontakte zwischen den Eltern einer Klasse positiv auf den Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf aus, insbesondere wenn es nur wenige Kinder mit Förderbedarf in einer Klasse gab.
Je stärker die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, dass ihre Fachlehrkräfte den Unterricht differenzieren und damit an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, desto stärker erleben die Lernenden ihre soziale Teilhabe.
INSIDE-Studie
Als Argument für Inklusion wird oft angeführt, dass Kinder ohne Förderbedarf in inklusiven Schulen ihr Sozialverhalten besser entwickeln können. Ob das tatsächlich so ist, kann die Studie weder bestätigen noch zurückweisen. Den Untersuchungen zufolge entwickelt sich die Sozialkompetenzen von Schülerinnen und Schülern ohne Förderbedarf weder systematisch besser noch schlechter, wenn sie unter inklusiven Bedingungen lernen oder nicht. Entscheidend sei aber das Klassenklima: „Wertschätzende Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern fördern die Entwicklung der Sozialkompetenzen“, heißt es.
Ein positiver Nebeneffekt von Inklusion: Offenbar lernen Kinder und Jugendliche die Prinzipien der Demokratie an inklusiv ausgerichteten Schulen besonders gut, ergab die Studie. „Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte berichten eine stärkere demokratische Ausrichtung der Schule, wenn diese sich aktiv um inklusive Lernumgebungen bemüht“, heißt es in einer Zusammenfassung der Studienergebnisse.
Soziale Teilhabe
Trotz aller Inklusionsbemühungen fühlen sich viele Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf nicht als vollwertiges Mitglied ihrer Klasse. Den Befragungen zufolge betrifft dieses Manko an sozialer Teilhabe vor allem Kinder mit Förderbedarf mit sozialemotionalen Entwicklungsproblemen. Zwar können Lehrkräfte das mit einer wertschätzende Beziehung zu den Kindern abpuffern, aber nur „etwas“.
Wird allerdings der Unterricht, etwa in Deutsch und Mathematik, sehr individuell gestaltet, dann wirkt sich das auch auf die soziale Teilhabe aus. „Je stärker die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, dass ihre Fachlehrkräfte den Unterricht differenzieren und damit an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, desto stärker erleben die Lernenden ihre soziale Teilhabe.“ Das gilt nicht nur, aber vor allem Kinder mit Förderbedarf.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: